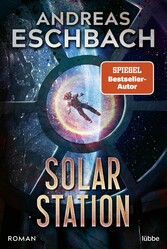Suchen und Finden
KAPITEL 2
Die Anspannung auf der Brücke war mit Händen zu greifen, als wir dort ankamen. Die Blicke, die uns trafen, waren nicht einmal wissend oder anzüglich wie sonst, sondern nur ungeduldig. Der Kommandant sah nur demonstrativ auf die so genannte Missionsuhr, deren große rote Ziffern nicht die laufende Uhrzeit, sondern den Countdown für ein aktuelles Vorhaben anzeigten: in diesem Fall die verbleibende Zeit bis zum Beginn des Kontaktes, noch fünf Minuten.
Wir nahmen schweigend unsere Plätze ein. In der Schwerelosigkeit setzt man sich natürlich nicht auf Stühle; das ist völlig unnötig. Es gab auf dem Boden vor den jeweiligen Schaltpulten Schlaufen am Boden, in die man die Füße steckte, und wenn man dann die Karabinerhaken, die an elastischen Schnüren an jedem Overall befestigt waren, an den entsprechenden Ösen einhakte, konnte man sich ganz auf seine Arbeit konzentrieren, ohne befürchten zu müssen, in einem unachtsamen Moment davonzuschweben.
Meine Aufgabe war, die Energieflusskontrollen im Auge zu behalten. Ich blickte über die Anzeigeinstrumente, verwirrend viele, zog einen Notizzettel aus der Tasche, den ich mir vorsorglich angefertigt hatte, und heftete ihn mit einem kleinen Magneten an eine freie Fläche. Das war ein Aushilfsjob für mich, weil Taka Iwabuchi, der für den Bereich Sonnenenergie zuständig war, sich diesmal unten im Maschinendeck aufhielt, um das Funktionieren der automatischen Anlagen zu überwachen. Oder das Nichtfunktionieren, um genau zu sein. Denn seit zwei Monaten gab es ständig Pannen bei der Energieübertragung.
Noch drei Minuten.
Yoshiko hatte ihren Platz an der Erdbeobachtung eingenommen. Ich riskierte einen kurzen Seitenblick. Sie drehte an Schaltern, drückte Tasten und war ganz bei der Sache, als wenn nichts gewesen wäre. Dann bemerkte ich einen mahnenden Blick von Moriyama, dem Kommandanten, und widmete mich angelegentlich wieder meinem Kontrollpult. Wenn nur nicht alles so groß in Japanisch und nur so klein – und unvollständig – in Englisch beschriftet gewesen wäre! Auch nach all den Jahren in den Diensten der japanischen Raumfahrt tat ich mich mit dem Lesen der japanischen Schrift immer noch schwer. Okay, ich konnte die Tageszeitung von Tokio entziffern, die wir täglich heraufgefaxt bekamen, aber in der Zeit, die ich für die Titelseite brauchte, hatte ich früher die New York Times einmal ganz durchgelesen.
Noch zwei Minuten.
»Hawaii, hier spricht die Raumstation NIPPON. Bitte kommen.« Das war Sakai, der für Funk, Datenübertragung und allgemeine Kommunikation zuständige Operator. Ein verschlossener, humorloser und ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, den ich noch nie mit jemandem aus der Crew ein längeres Gespräch hatte führen sehen. Wahrscheinlich hatte er sich beruflich der Kommunikation verschrieben, weil er sie privat absolut nicht beherrschte. Auch dass er fließend Englisch sprach, änderte daran nichts.
»NIPPON, hier Hawaii«, drang die Stimme des Funkers unten an der Empfangsanlage aus dem Lautsprecher. »Wir haben Sie geortet.«
»Hawaii, wir sind bereit für den Empfang Ihres Leitstrahls in« – er blickte auf die Missionsuhr – »einer Minute und vierzig Sekunden.«
»Bestätigt. Wir sind synchron.«
Ein meckerndes Lachen quittierte diese Durchsage. Sie stammte von James Prasad Jayakar, dem Computerspezialisten, den auf seinen eigenen Wunsch hin alle nur Jay nannten. Er war der Sohn eines indischen Physikers und einer englischen Kybernetikerin und vor kurzem direkt von Cambridge weggekauft worden. Wenn man sich nicht an seinem, vorsichtig ausgedrückt, ziemlich eigenwilligen Charakter stieß, war gut mit ihm auszukommen, und wenn man bedachte, dass diese Dienstschicht – er war mit dem vorletzten Shuttle vor vier Monaten an Bord gekommen – sein erster Aufenthalt im Weltraum war, dann hielt er sich erstaunlich gut.
Alle Augen fixierten nun die Missionsuhr. Die Sekunden verstrichen so langsam, als ginge der Zeit ausgerechnet jetzt der Sprit aus.
In Hawaii ging in diesen Minuten die Sonne unter, und von dort aus gesehen tauchten wir am nördlichen Horizont auf, als winziger, aber mit bloßem Auge gut sichtbarer Punkt am klaren Abendhimmel. In wenigen Augenblicken würden sie uns einen Laserstrahl entgegenschicken, der genau auf unseren Energiesender gerichtet sein würde. Und an diesem Laserstrahl entlang sollte unsere Energie hinab zur Erde fließen, um dort von einem riesigen Empfängergitter aufgenommen zu werden, das, beinahe einen Quadratkilometer groß, nördlich der kleinen Insel Nihoa im Pazifik dümpelte.
Das hatte auch schon funktioniert. Nur seit zwei Monaten war der Wurm drin.
Noch fünfundvierzig Sekunden.
Jeder denkt, das Aussehen der Raumstation sei leicht zu beschreiben, solange er es noch nicht versucht hat. Klar, man weiß, dass es sich um eine Versuchsstation handelt, die hauptsächlich gebaut wurde, um verschiedene Aspekte der Energiegewinnung aus Sonnenlicht und der Übertragung von Energie aus dem Weltraum zur Erde zu erforschen und die zugehörige Technologie zu entwickeln. Und man kann sich auch denken, dass die Raumstation dazu ziemlich große Flächen haben muss, die im Volksmund als Solarzellen oder Sonnenpaddel bezeichnet werden. Was man sich aber nicht denken kann, ist, wie groß diese Flächen tatsächlich sind.
Am eindrücklichsten fand ich eine Beschreibung, die einmal in einem von der japanischen Raumfahrtbehörde herausgegebenen Prospekt stand. Stellen Sie sich vor, hieß es dort, Sie hätten eine kreisrunde Scheibe feinen weißen Papiers, einen halben Meter im Durchmesser, gerade so groß, dass ein Erwachsener sie mit ausgestreckten Armen umfassen kann. Durch den Mittelpunkt dieser Scheibe sei eine kleine Nadel gesteckt. Der winzige Kopf dieser Nadel – das ist die eigentliche Raumstation. Hier leben, arbeiten und schlafen die Mitglieder der Besatzung; hier werden wissenschaftliche Experimente aller Art gemacht, und hier sind auch alle Maschinen untergebracht, die zur Versorgung mit Wasser und Atemluft erforderlich sind. Die Spitze der Nadel ist in Wirklichkeit eine hundertfünfzig Meter lange, ölbohrturmartige filigrane Stabkonstruktion, an deren Ende der Energiesender sitzt. Und die Papierscheibe – das sind die Solarzellen.
Nur dass es keine Solarzellen im herkömmlichen Sinn sind. Es handelt sich um eine hauchdünne Folie, die nur unter Schwerelosigkeit hergestellt werden kann – und die wir deshalb hier an Bord herstellen –, die zwischen lächerlich mageren Trägern aufgespannt ist und die eine Energieausbeute von ungefähr hundert Watt je Quadratmeter liefert. Und dieser Quadratmeter hat, inklusive der Träger und Energieleitungen, eine Masse von durchschnittlich gerade mal zehn Gramm – weitaus weniger als Papier also.
Und das Ganze ist wirklich riesig. Es schneidet unser Sichtfeld buchstäblich in zwei Hälften. Wenn wir in der Station aus einem Fenster sehen, sehen wir ringsum diese endlose, wie frisch gefallener Schnee schimmernde Fläche, die bis zum Horizont reicht, und darüber den halben Sternhimmel. Und um diese Jahreszeit auch nur die halbe Erde, die immer am Rand der Scheibe entlangwanderte.
Man kann im Weltraum, wo alle Belastungen durch Schwerkraft und Luftwiderstand wegfallen, wirklich riesenhafte Gebilde bauen, ohne Probleme zu bekommen. Mitsubishi Industries dachte zurzeit darüber nach, die nächste Version einer Solarstation zu sponsern, unter der Auflage, dass die Sonnenfläche in Form des Mitsubishi-Firmenlogos und so groß gebaut würde, dass sie mit bloßem Auge von der Erde aus gesehen werden konnte. Ich weiß auch genau, was sich Coca-Cola und McDonald’s zu diesem Thema ausgedacht hätten, wenn sie heute noch die Firmen gewesen wären, die sie in meiner Jugend gewesen waren.
»Noch zehn Sekunden«, sagte Moriyama.
Ich starrte meine Anzeigeinstrumente an und bedauerte, nicht aus dem Fenster schauen zu können, was ich sonst oft tat bei den Übertragungsmanövern. In dem Moment nämlich, in dem die darin erzeugte Energie floss, wurde die sonst blendend weiße Fläche auf einmal tiefschwarz, und vor dem Hintergrund des Alls wirkte das, als verschwände sie von einem Moment zum anderen spurlos.
»Wir empfangen den Leitstrahl!«, verkündete Sakai. »Energie frei!«, befahl Moriyama.
Das galt mir. Ich legte den entsprechenden Hebel um und bildete mir ein, dass ein feines Rucken durch die ganze Station ging. Die Anzeigen wanderten rasch in die grünen Bereiche. »Energie fließt«, verkündete die Stimme Iwabuchis aus dem Lautsprecher der Bordsprechanlage.
»NIPPON, hier Hawaii. Wir empfangen Sie mit zwei Prozent der Nennleistung.«
»Go-fun. Wir warten fünf Minuten, dann erhöhen wir«, ordnete Moriyama an.
»Hawaii, hier NIPPON«, sagte Sakai. »Wir senden für fünf Minuten nur den Orientierungsstrahl.«
»Verstanden, NIPPON.«
Gespanntes Schweigen. Es war nichts zu hören, kein Wummern von Maschinen, kein Surren und kein Rattern, nichts. Was die normale sinnliche Wahrnehmung anbelangte, hätte alles ebensogut ein Computerspiel sein können.
Jay brach das Schweigen mit dem Wort, das alle gefürchtet hatten. »Vibrationen.«
Ein Fluch auf Japanisch, der sicher nicht für unsere Ohren gedacht war, kam über die Sprechanlage. Iwabuchi. Ich verstand kein Wort, aber Yoshiko neben mir schien zu erröten. »Strahl beginnt zu wandern«, sagte sie dann, »ist aber noch im Zielbereich.«
»Vibrationen werden stärker«, verkündete Jay.
»Strahl verlässt den Zielbereich!«, rief Yoshiko. Unter der Konsole vor mir ertönte ein...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.