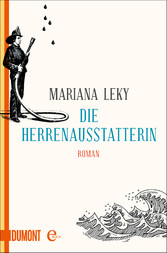Suchen und Finden
Bis später
Alles hätte gut und gern so weitergehen können, aber dann ist alles zerbrochen, was, wie Blank später sagte, ein sicheres Zeichen dafür ist, dass es eben nicht so habe weitergehen können, auch wenn ich das geglaubt hatte. Was man selber glaubt, ist, auch das sagte Blank später, manchmal unmaßgeblich in der Frage, ob etwas zerbrochen gehört oder nicht.
Morgens, wenn ich aufwachte, war Jakob längst wieder da oder gar nicht weg gewesen. Er lag neben mir in meinem Bett, je nach Jahreszeit unter einem Laken oder einer Decke. Jakob schlief wie ein Toter und brauchte anschließend lange, um richtig wach zu werden. Oft verschlief er und wachte erst auf, wenn die Sprechstundenhilfe anrief und sagte: »Sie müssten jetzt wirklich mal kommen, hier ist alles voller Schmerzpatienten.« Dann stieg Jakob schlaftrunken in seine Kleider, ging schlaftrunken los, kaufte unterwegs einen Kaffee zum Mitnehmen, er tat das ohne Worte, weil man ihn in der Kaffeebar kannte, er kam schlaftrunken in die Praxis und durchquerte schlaftrunken sein volles Wartezimmer. Seine Sprechstundenhilfe wusste, dass Jakob morgens dankbar war für jedes Wort, das er nicht sagen oder hören musste, deshalb sagte sie nichts, folgte ihm ins Behandlungszimmer, zog ihm dort den zerdrückten Kaffeepappbecher aus der Jackentasche, reichte ihm den frisch gewaschenen Kittel und wies Jakob, kurz bevor der erste Schmerzpatient hereinkam, wortlos auf den Schlaf in seinen Augenwinkeln hin. Es ist beunruhigend, von jemandem behandelt zu werden, der noch Schlaf in den Augen hat.
Jakob war Zahnarzt. Ich lernte ihn kennen, als meine Zähne schlecht waren, deshalb kannte ich mich mit Zahnärzten gut aus und wollte eigentlich keinen neuen mehr kennenlernen. Ich kannte mich mit den Wartezimmern aus, in denen hauptsächlich Leute sitzen, die aussehen, als kämen sie nur mal so zur Kontrolle. Ich kannte den Zahnarztbegrüßungshandschlag, ein kurzer fester Griff mit einer vom vielen Waschen farblosen und wachsweichen Hand. Ich kannte das ungeduldige Zahnarztnicken, wenn man dem Zahnarzt noch etwas sagen möchte, bevor man den Mund aufsperrt und nichts mehr sagen kann. Man fängt bereits im Türrahmen des Behandlungszimmers an zu reden, um auf dem kurzen Weg zwischen Tür und Behandlungsstuhl alles gesagt zu haben, man verhaspelt sich dabei in dem Versuch, zahnarztwunschgemäß schneller zu reden, rasant schildert man Ort und Stärke der Beschwerden und beteuert rasant, dass man wirklich jeden Abend mit Zahnseide und Zahnhölzchen, Interdentalbürstchen und Munddusche hantiert hat, weil man sich gut mit jemandem stellen will, der wahrscheinlich gleich dafür sorgt, dass es schmerzhaft wird. Leider vergisst man dabei immer, dass der Zahnarzt mit Beteuerungen nichts anfangen kann. Der Zahnarzt will, dass man noch rasanter schildert, die Beteuerungen am besten ganz auslässt und endlich den Mund aufsperrt.
Ich kannte den Satz, den Zahnärzte sagen, wenn der Mund endlich aufgesperrt ist: »Wir werden uns noch ein paar Mal wiedersehen müssen«, sagen sie, bevor sie anfangen zu behandeln. Ich kannte auch die anschließende Schweigsamkeit der Zahnärzte. Zahnärzten hat man nicht beigebracht, dass manche Dinge weniger schmerzhaft sind, wenn man erklärt bekommt, was warum und wie lange schmerzhaft sein wird. Ich kannte den leeren Blick der Zahnärzte, wenn sie mit ihren Bohrern hantieren, die sich immer anhören wie ein versehentlich angerufenes Faxgerät, nur viel lauter.
Als mein damaliger Zahnarzt im Urlaub war, ging ich zu seiner Vertretung. Die Vertretung war Jakob, der damals noch Dr. J. Wiesberg hieß. In seinem Wartezimmer saß niemand nur mal so zur Kontrolle.
Als ich Jakob zum ersten Mal sah, war er ausgeschlafen, mein Termin lag am frühen Nachmittag. Als er mir zur Begrüßung die Hand gab, lief ihm eine Träne über die Wange.
»Weinen Sie?«, fragte ich, weil mich die unverhoffte Regung erstaunte. Außerdem ist es beunruhigend, von einem weinenden Zahnarzt behandelt zu werden.
»Ich weine nicht«, sagte er, »meine Augen sind nur zu trocken.« Er zog ein Fläschchen aus seiner Kitteltasche und hielt es mir hin. Tears again, stand darauf, und Jakob erklärte, dass er sich die Flüssigkeit regelmäßig in seine zu trockenen Augen träufeln müsse, was dazu führe, dass ab und zu eine Träne unkontrolliert über seine Wange laufe.
Ich drehte das Fläschchen in den Händen und wusste nicht, was ich sagen sollte, weil mir noch nie ein Zahnarzt etwas von sich gezeigt hatte, und schließlich sagte ich: »Es hat ein benutzerfreundliches Design.« Jakob nickte und lächelte mich an. Ich gab ihm das Fläschchen zurück und sagte möglichst schnell Sachen, die man vorher noch sagen will, und Jakob nickte kein bisschen, sondern stellte konstruktive Fragen. Er besah sich meine Zähne, murmelte Buchstaben und Zahlen und sagte: »Wir werden uns noch ein paar Mal wiedersehen.«
»Heben Sie bitte sofort die Hand, wenn es schmerzhaft wird, dann hören wir schnurstracks auf«, sagte er, als er anfing zu behandeln, und dann: »Und jetzt denken Sie mal an was Schönes.«
Weil es sich anbot, dachte ich an Jakob, denn Jakob war schön, obwohl er Zahnarzt war. Jakob bohrte an meinem Zahn herum und sagte mehrmals, ich solle sofort die Hand heben, wenn es schmerzhaft würde, denn dann würden wir schnurstracks aufhören, er sagte das nachdrücklich, als seien wir nicht bei einer Zahnbehandlung, sondern auf einer besonders waghalsigen Expedition, die ich als Erste unternahm. Jakob erklärte ausführlich, was warum wie lange eventuell schmerzhaft sein könnte, er war kein bisschen schweigsam. »Sie machen das wirklich wunderbar«, sagte er, obwohl es gar nicht besonders schmerzhaft war, »Sie machen das mit Bravour«, er sagte: »Menschen, die Schmerzen mit solcher Geduld begegnen, sind selten« und: »Sie ertragen das mit der Ruhe eines indischen Yogi.« Er sagte das alles ernst und leise, und spätestens jetzt wusste ich, warum Jakobs Wartezimmer so voll war. Ich freute mich, ausgerechnet an Jakob geraten zu sein, und als es dann doch etwas schmerzhaft wurde, hob ich nicht die Hand, sondern schaute auf ein großes Schild, das an der Decke über dem Behandlungsstuhl hing. In großen Buchstaben stand darauf: Gleich ist es vorbei.
Tatsächlich war es gleich vorbei, und tatsächlich hatte niemand eine Ahnung davon, dass genau jetzt die Sache mit Jakob losging. Es ist ganz und gar normal und ganz und gar ungeheuerlich, dass man immer ahnungslos ist, wenn solche Sachen ihren Anfang nehmen. Nie hat man bei ihrem Losgehen eine Ahnung von ihrem Ausmaß und ihrer Wucht oder davon, was warum und wie lange schön oder schmerzhaft sein wird, und ich wünschte, ich wüsste, was gewesen wäre, wenn auf dem Schild über dem Behandlungsstuhl nicht Gleich ist es vorbei, sondern Jetzt geht es los gestanden hätte. Wenn dort Das ist Jakob, jetzt geht es los, und es wird sehr, sehr lange nicht vorbei sein, gestanden hätte. Und: Es wird schön, so schön, wie noch nie etwas war, und dann wird es schmerzhaft, so schmerzhaft, wie noch nie etwas war, aber leider zu spät sein, um schnurstracks aufzuhören, wenn da gestanden hätte, was genau wie schön oder schmerzhaft sein würde, ich wünschte, ich wüsste, was passiert wäre, wenn ich all das hätte lesen können auf dem Schild über dem Behandlungsstuhl, während ich einen Bohrer und ein Absauggerät im Mund hatte und Dr. J. Wiesberg konzentriert meinen Zahn behandelte.
Vielleicht wäre nichts anders gewesen und ich nur erstaunt, dass ich ausgerechnet an einen Zahnarzt geraten wäre. Vielleicht wäre ich glücklich über den Teil mit dem nie dagewesenen Schönen gewesen, und vielleicht hätte ich über den Teil mit dem nie dagewesenen Schmerzhaften gedacht: »Das wollen wir ja mal sehen«, so, wie ein herkömmlicher Zahnarzt es sagt, wenn man ihm bereits beim Reinkommen etwas von Hölzchen und Bürstchen erzählt.
Wenn Jakob am Vormittag aufstand, war ich schon weg, ich stand früh auf und ging übersetzen. Ich übersetzte von Montag bis Freitag in einem Großraumbüro Gebrauchsanweisungen, Berichte, Broschüren und Beipackzettel, Werbetexte und besinnliche Sprüche und ab und zu ein Schild. Es gab viel zu übersetzen und einen Chef, der Bengt hieß. Bengt ist ein Name, der, wenn man ihn mehrmals hintereinander ruft, klingt wie ein aufprallender Ball, und Bengt wurde oft gerufen. »Bengt! Bengt!«, rief immer irgendwer, der mit seiner Übersetzung nicht weiterwusste. Dann kam Bengt, er hatte einen schnellen, hüpfenden Gang und sah immer aus, als würde Gott ihn dribbeln.
Es gab regelmäßige Arbeitszeiten und einen eigenen Schreibtisch, auf dem kein Foto von Jakob stand. Ich hätte nichts dagegen gehabt, eines hinzustellen, viele im Großraumbüro hatten Fotos von nahestehenden Menschen oder Tieren auf ihrem Schreibtisch, aber Jakob fand gerahmte Nahestehende eine Unart und war überzeugt, dass ich das auch fände.
Evelyn, die neben mir übersetzte, fand meinen Schreibtisch kahl. Auf ihrem standen Fotos von diversen Männern und Frauen in bunten, kleinen und großen Rahmen, verflossene und aktuelle Lieben und Tanten und Neffen, außerdem zu jeder Jahreszeit eine Schale voller Marzipankartoffeln. Evelyn bekam die Marzipankartoffeln von ihren Verehrern. Weil Evelyn viele Verehrer hatte, war sie etwas dick geworden und hatte sich vorgenommen, nicht mehr alle Marzipankartoffeln selber zu essen. Sie brachte die geschenkten Marzipankartoffeln mit ins Büro, stellte sie teilweise zur freien Verfügung auf ihren Schreibtisch und verteilte sie teilweise in Tüten unter den Kollegen, damit wir sie aufbewahrten für die Zeit, wenn die Wirkung der ganzen Marzipankartoffeln in Evelyn wieder nachgelassen hatte und Raum für neue war.
Die Wirkung...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.