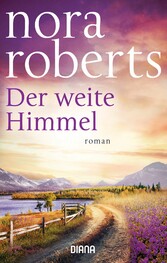Suchen und Finden
KAPITEL 1
Jack Mercys Tod änderte nichts an der Tatsache, dass er ein elender Hundesohn war. Die eine Woche, die er nun friedlich im Sarg lag, wog die achtundsechzig Jahre eines Lebens voller Niedertracht bei Weitem nicht auf, und viele der Menschen, die an seinem Grab zusammengekommen waren, hätten ihrem Herzen nur zu gerne Luft gemacht.
Begräbnis hin, Begräbnis her, Bethanne Mosebly flüsterte ihrem Mann ebenjene unfreundlichen Äußerungen ins Ohr, während sie im hohen Gras des Friedhofes standen. Nur ihre Zuneigung zu der jungen Willa hatte sie überhaupt hierhergeführt, und auch diese Bemerkung war während der gesamten Fahrt von Ennis bis zum Friedhof wieder und wieder gefallen.
Bob Mosebly, der das Geschnatter seiner Frau seit nunmehr sechsundvierzig Jahren ertrug, gab einen unverbindlichen Laut von sich und blendete dann ihre Stimme sowie die eintönige Rede des Pfarrers einfach aus. Nicht dass Bob freundliche Erinnerungen an Jack hegte. Er hatte den alten Bastard gehasst – wie fast jede lebende Seele im Staate Montana.
Inzwischen hatte sich in jenem idyllischen Eckchen der Mercy Ranch, die im Schatten der Big Belt Mountains nahe dem Ufer des Missouri lag, eine beachtliche Menschenmenge eingefunden, die sich hauptsächlich aus Ranchern, Cowboys, Kaufleuten und Politikern der Umgebung zusammensetzte. Hier, wo das Vieh friedlich auf den Hügeln graste und Pferde über die sonnigen Weiden galoppierten, lagen Generationen von Mercys unter dem sacht im Winde wehenden Gras begraben.
Jack war der letzte. Er selbst hatte den Sarg aus schimmerndem Kastanienholz bestellt, der eigens für ihn angefertigt und mit den ineinander verschlungenen goldenen Ms, dem Zeichen der Mercy Ranch, versehen worden war. Nun schlummerte er, bekleidet mit seinen besten Schlangenlederstiefeln und seinem uralten Lieblingsstetson, seinen Ochsenziemer zwischen den gefalteten Händen, für immer in der mit weißem Satin ausgeschlagenen Kiste.
Jack hatte stets erklärt, er wolle so abtreten, wie er gelebt hatte: in großem Stil.
Man erzählte sich, dass Willa bereits, den Instruktionen ihres Vaters Folge leistend, einen Grabstein bestellt hatte. Aus weißem Marmor sollte er sein – keinen gewöhnlichen Granitstein für Jackson Mercy, o nein –, und die Inschrift, die darin eingemeißelt werden sollte, hatte er auch bestimmt.
Hier ruht Jack Mercy
Er lebte, wie es ihm gefiel, und so starb er auch
Wem das nicht passt, der soll zum Teufel gehen
Sobald die Erde sich gesenkt hatte, würde der Stein aufgestellt werden und sich zu all den anderen gesellen, die verstreut auf dem steinigen Land standen. Alle Mercys lagen hier, angefangen bei Jacks Urgroßvater Jebidiah Mercy, der die Berge durchstreift und sich schließlich auf diesem Fleckchen Erde niedergelassen hatte, bis hin zu Jacks dritter Frau – der einzigen, die gestorben war, ehe er sich von ihr scheiden lassen konnte.
War es nicht eine Laune des Schicksals, grübelte Bob, dass ihm jede seiner Frauen eine Tochter geschenkt hatte, obwohl er sich doch nichts sehnlicher wünschte als einen Sohn? Vielleicht hatte Gott auf diese Weise einen Mann gestraft, der in jeder Hinsicht über Leichen ging, um das zu bekommen, was er wollte.
Bob konnte sich an jede von Jacks Frauen noch gut erinnern, obwohl keine lange geblieben war. Bildhübsch waren sie gewesen, alle drei, und auch die Töchter konnte man nicht gerade als hässlich bezeichnen. Bethanne hatte die Telefonleitungen zum Glühen gebracht, als bekannt geworden war, dass Mercys beide älteren Töchter zu seiner Beerdigung erscheinen würden. Keine hatte je zuvor einen Fuß auf Mercy-Land gesetzt. Sie wären auch nicht willkommen gewesen.
Nur Willa war geblieben. Mercy hatte kaum etwas dagegen unternehmen können, da ihre Mutter gestorben war, als sie noch in den Windeln lag. Da er keine Freunde oder Verwandten besaß, denen er das Kind hätte aufbürden können, wurde das Baby der Obhut seiner Haushälterin anvertraut, und Bess hatte das Mädchen großgezogen, so gut sie konnte.
Jede der drei Frauen hatte etwas von Jack, stellte Bob fest, während er sie unter der Krempe seines Hutes hervor betrachtete. Das dunkle Haar, das energische Kinn. Man sah sofort, dass es sich um Schwestern handelte, obwohl die drei sich noch nie begegnet waren. Mit der Zeit würde sich herausstellen, ob sie miteinander auskamen, und mit der Zeit würde sich auch zeigen, ob Willa genug von Jack Mercy in sich hatte, um eine fünfundzwanzigtausend Morgen umfassende Ranch zu leiten.
Auch Willa dachte an die Ranch und an die Arbeit, die vor ihr lag. Es war ein herrlicher klarer Morgen, und die Natur prunkte mit leuchtenden Farben, deren Intensität für die Augen fast schmerzhaft war. Die Berge und das Tal mochten zwar schon ihr Herbstgewand angelegt haben, doch der heiße, trockene Chinookwind war noch einmal zurückgekehrt. An diesem Tag Anfang Oktober war es warm genug, um in Hemdsärmeln herumzulaufen, doch das konnte sich morgen schon ändern. In den höheren Lagen hatte es bereits geschneit, Willa konnte die mit Schnee bedeckten Gipfel und Wälder sehen. Das Vieh musste zusammengetrieben, die Zäune überprüft, repariert und wieder überprüft werden. Auch die Wintersaat war fällig.
Das war nun ihre Aufgabe. Alles lag in ihren Händen. Jack Mercy war nicht länger Herr über die Mercy Ranch, sondern sie.
Sie hörte zu, als der Priester von immerwährendem Leben, Vergebung aller Sünden und Aufnahme in die himmlischen Gefilde sprach, und dachte, dass sich ihr Vater einen Dreck um seine mögliche Einkehr in den Himmel geschert hätte. Zeit seines Lebens hatte er sich nur in seinem eigenen Heim wohlgefühlt. Montana war seine Heimat gewesen, dieses weite Land der Berge und der Weiden, der Adler und der Wölfe.
Ihr Vater wäre im Himmel genauso unglücklich wie in der Hölle.
Willas Gesicht zeigte keine Regung, als der protzige Sarg in die frisch ausgehobene Grube hinabgelassen wurde. Sie hatte eine zart goldfarbene Haut, die sie zum einen der Sonne, zum anderen dem indianischen Blut, Erbteil ihrer Mutter, verdankte. Ihre Augen, fast ebenso schwarz wie ihr Haar, das sie für das Begräbnis hastig zu einem unordentlichen Zopf geflochten hatte, waren unverwandt auf die letzte Ruhestätte ihres Vaters gerichtet. Sie trug keinen Hut, sodass die Sonne ihre Augen aufleuchten ließ. Doch sie vergoss keine Träne.
Willa hatte stolze Gesichtszüge, hohe Wangenknochen, einen breiten, ein wenig hochmütigen Mund und dunkle, exotische Augen mit schweren Lidern und dichten Wimpern. Im Alter von acht Jahren war sie von einem bockenden Mustang gestürzt und hatte sich dabei die Nase gebrochen, die seither leicht nach links zeigte. Willa tröstete sich damit, dass die kleine Entstellung ihrem Gesicht Charakter verlieh. Charakter bedeutete Willa Mercy sehr viel mehr als bloße Schönheit. Männer respektierten schöne Frauen nicht, so viel wusste sie. Sie benutzten sie nur.
Regungslos stand sie da, während sich einzelne Strähnen aus ihrem Zopf lösten und im Wind tanzten; eine Frau von durchschnittlicher Größe, schlank und geschmeidig gebaut, in einem schlecht sitzenden schwarzen Kleid und hochhackigen schwarzen Schuhen, die bis zu diesem Morgen ihren Karton noch nie verlassen hatten. Eine Frau von vierundzwanzig Jahren, deren Gedanken um ihre Arbeit kreisten und die einen brennenden Schmerz mit sich herumtrug.
Sie hatte Jack Mercy trotz all seiner Fehler geliebt. Und sie hatte kein einziges Wort für die beiden fremden Frauen gefunden, in deren Adern dasselbe Blut floss und die gekommen waren, um ihrem Vater das letzte Geleit zu geben.
Flüchtig wanderte ihr Blick zum Grab von Mary Wolfchild Mercy und verharrte dort einen Augenblick. Die Mutter, an die sie sich nicht mehr erinnern konnte, lag unter einem sanften, mit Wildblumen bepflanzten Hügel begraben. Die Blüten schimmerten im Licht der Herbstsonne wie bunte Edelsteine. Adams Werk, dachte sie, hob den Blick und sah ihrem Halbbruder in die Augen. Er wusste besser als jeder andere, dass sie den Tränen, die tief in ihr aufstiegen, niemals freien Lauf lassen konnte.
Als Adam ihre Hand ergriff, schlossen sich ihre Finger um die seinen. Er war jetzt alles an Familie, was ihr noch blieb.
»Er hat sein Leben in vollen Zügen genossen«, murmelte Adam. Seine Stimme klang weich und beruhigend. Wären sie allein gewesen, hätte Willa sich zu ihm umdrehen, ihren Kopf an seiner Schulter bergen und dort Trost finden können.
»Ja, das hat er. Und nun ist es vorüber.«
Adam schaute zu den beiden Frauen, Jack Mercys anderen beiden Töchtern, hinüber und dachte, dass etwas anderes gerade erst begann. »Du musst mit ihnen sprechen, Willa.«
»Sie schlafen unter meinem Dach, essen an meinem Tisch.« Absichtlich blickte Willa wieder auf das Grab ihres Vaters. »Das ist genug.«
»Sie sind deine Blutsverwandten.«
»Nein, Adam, du bist mein Blutsverwandter. Sie bedeuten mir nichts.« Willa wandte sich von ihm ab und sammelte Kraft, um die Beileidsbezeugungen entgegenzunehmen.
Gab es in einer Familie einen Todesfall, so brachten die Nachbarn Lebensmittel und Kuchen vorbei. Diese tief verwurzelte Tradition ließ sich nicht unterbinden. Auch hatte Willa Bess nicht daran hindern können, für drei Tage im Voraus zu kochen, um für das gerüstet zu sein, was die Haushälterin ein Trauermahl nannte. Und das war in Willas Augen eine lächerliche Farce. Nicht die Trauer hatte die Leute zu ihnen getrieben, sondern schiere Neugier. Viele von ihnen, die jetzt im Haupthaus versammelt waren, waren nicht zum ersten Mal da. Jack Mercys Tod...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.