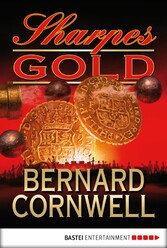Suchen und Finden
KAPITEL 1
Der Krieg war verloren – noch nicht zu Ende, aber verloren. Alle wussten es, von den Divisionsgenerälen bis zu den Dirnen Lissabons: dass die Briten in die Falle gegangen und eingemacht worden waren, bereit für den Kochtopf. Ganz Europa wartete darauf, dass der Meisterkoch Bonaparte die Berge überqueren und persönlich letzte Hand an den Braten legen würde.
Dann fügte sich Schimpf zur bevorstehenden Schande. Wie es schien, war das kleine britische Heer der Aufmerksamkeit des großen Bonaparte nicht wert. Der Krieg war verloren.
Spanien war besiegt. Die letzten spanischen Armeen waren aufgerieben, auf dem Scheiterhaufen der Geschichte gelandet. Übrig blieben nur der befestigte Hafen von Cádiz und die Bauern, die die »Guerilla« ausfochten, den »kleinen Krieg«. Sie kämpften mit spanischen Messern und britischen Gewehren, mit Hinterhalten und Terroranschlägen, bis die französischen Truppen das spanische Volk hassen und fürchten lernten. Aber der kleine Krieg war nicht der wahre Krieg, und der, darin war man sich einig, war verloren.
Captain Richard Sharpe, vormals Angehöriger der 95th Rifles Seiner Majestät, nun Offizier der Leichten Kompanie des South Essex Regiments, hielt den Krieg nicht für verloren, war jedoch trotzdem übel gelaunt, verdrießlich und reizbar. Der Regen, der seit Tagesanbruch gefallen war, hatte die staubige Straßendecke in glitschigen Schlamm verwandelt und seine Schützenuniform unangenehm klamm werden lassen. Er hatte sich abgesondert und marschierte schweigend dahin, dem Geschwätz seiner Männer lauschend. Lieutenant Robert Knowles und Sergeant Patrick Harper, die sich normalerweise zu ihm gesellt hätten, ließen ihn in Ruhe. Lieutenant Knowles hatte sich zu einer Bemerkung über Sharpes Laune hinreißen lassen, doch der hünenhafte irische Sergeant hatte den Kopf geschüttelt.
»Keine Chance, ihn aufzumuntern, Sir. Es gefällt ihm, mieser Laune zu sein, wahrhaftig. Wie ich den Bastard kenne, wird er von allein darüber hinwegkommen.«
Knowles zuckte mit den Schultern. Er fand es ganz und gar unpassend, dass ein Sergeant einen Captain mit »Bastard« betitelte, aber es hatte keinen Sinn, sich dagegen zu verwahren. Der Sergeant würde nur unschuldig dreinblicken und Knowles wahrheitsgemäß versichern, dass die Eltern des Captains nicht verheiratet gewesen seien. Obendrein hatte Patrick Harper jahrelang an Sharpes Seite gekämpft und eine Freundschaft zu dem Captain aufgebaut, um die Knowles ihn richtiggehend beneidete. Knowles hatte Monate gebraucht, diese Freundschaft zu verstehen. Sie gründete sich nicht, wie viele Offiziere annahmen, auf die Tatsache, dass Sharpe früher einmal als einfacher Soldat in Reih und Glied marschiert war und gekämpft hatte und deshalb nun, nachdem ihm die Ehre zuteil geworden war, der Offiziersmesse angehören zu dürfen, weiterhin die Gesellschaft der Mannschaften suchte.
»Einmal ein Bauer, immer ein Bauer«, hatte ein Offizier gespöttelt. Sharpe hatte es gehört und den Mann angesehen, und Knowles hatte erlebt, wie unter diesem frostigen, herausfordernden Blick dem anderen die Angst kam. Außerdem verbrachten Sharpe und Harper nicht etwa ihre Freizeit miteinander. Ihr Rangunterschied machte es unmöglich. Dennoch erkannte Knowles hinter aller Förmlichkeit die Freundschaft. Beide waren sie hochgewachsene Männer, der Ire noch dazu bärenstark, und beide vertrauten sie auf ihre Fähigkeiten.
Knowles konnte sich keinen von ihnen ohne Uniform vorstellen. Sie waren für ihr Gewerbe wie geschaffen, und ausgerechnet in der Schlacht, wenn die meisten Männer ängstlich auf ihr eigenes Überleben bedacht waren, herrschte dieses unheimlich anmutende Einverständnis zwischen Sharpe und Harper. Beinahe so, als seien sie auf dem Schlachtfeld zu Hause, dachte Knowles und beneidete sie.
Er blickte zum Himmel auf, zu den niedrigen Wolken, die zu beiden Seiten der Straße die Hügelkämme berührten. »Verfluchtes Wetter.«
»Bei uns daheim, Sir, würden wir’s einen schönen Tag nennen!« Harper grinste Knowles zu. Dabei tropfte ihm der Regen vom Tschako. Dann sah er sich nach der Kompanie um, die Sharpes eilig marschierender Gestalt folgte. Die Männer waren ein wenig aus dem Tritt, rutschten immer wieder aus. Da erhob Harper seine Stimme. »Auf, ihr Protestantenpack! Der Krieg wartet nicht auf euch!«
Er begleitete sein Gebrüll mit einem Grinsen, denn er war stolz, dass sie schneller vorankamen als das übrige Regiment, und froh darüber, dass das South Essex endlich nach Norden aufgebrochen war, wo die Schlachten des Sommers geschlagen werden sollten.
Patrick Harper hatte – wie alle anderen – die Gerüchte über die französische Streitmacht und ihren neuen Kommandanten gehört, aber er dachte nicht daran, sich wegen der Zukunft schlaflose Nächte zu machen, auch wenn das South Essex von der Zahl her jämmerlich unterlegen war.
Im März waren in Portsmouth Ersatzeinheiten in See gestochen, aber der Konvoi war in einen Sturm geraten, und Wochen später hieß es, an den Stränden der südlichen Biscaya seien Hunderte von Leichen angespült worden. Jedenfalls musste das Regiment nun mit weniger als der Hälfte seiner Sollstärke in den Kampf ziehen. Harper war es egal. Auch in Talavera war das Heer zahlenmäßig zwei zu eins unterlegen gewesen, und am heutigen Abend würde es in der Stadt Celorico, wo sich die Truppen sammelten, auf den Straßen Frauen geben und Wein in den Geschäften. Für einen Jungen aus Donegal konnte es im Leben weitaus schlimmer zugehen. Patrick Harper begann zu pfeifen.
Sharpe hörte das Pfeifen und widerstand dem Impuls, den Sergeant anzuschnauzen. Er erkannte diesen Impuls als Folgeerscheinung seiner Gereiztheit, konnte aber nicht umhin, sich darüber zu ärgern, dass Harper seine übliche Gelassenheit zur Schau stellte. Sharpe glaubte nicht, dass an den Gerüchten über die Niederlage etwas dran war, denn für einen Soldaten war solch eine Schlappe undenkbar. Die passierte nur dem Feind.
Andererseits verachtete Sharpe sich selbst, weil ihm die unbarmherzige Logik der Zahlen zusetzte. Das Debakel lag in der Luft, ob er es nun glaubte oder nicht. Er musste ständig daran denken und marschierte deshalb noch schneller, als sei die beschwerliche Gangart geeignet, jedweden Pessimismus auszulöschen.
Immerhin unternahmen sie endlich etwas. Seit Talavera hatte das Regiment an der öden Südgrenze zwischen Spanien und Portugal Patrouillendienst geleistet, und der Winter war lang und eintönig gewesen. Die Sonne war auf- und wieder untergegangen, das Regiment war zum Drill angetreten, sie hatten die menschenleeren Hügel beobachtet, und es hatte zu viel Muße gegeben, zu viel Weichlichkeit. Die Offiziere hatten die zurückgelassene Brustplatte eines französischen Kavalleristen gefunden und als Rasierschüssel benutzt, und Sharpe hatte zu seiner Empörung festgestellt, dass er den Luxus heißen Wassers in einer Schüssel als alltägliches Ereignis hinzunehmen begann!
Und dann die Hochzeiten. Zwanzig allein während der letzten drei Monate. So war es gekommen, dass meilenweit hinter ihnen die übrigen neun Kompanien des South Essex eine bunte Prozession aus Frauen und Kindern, Ehefrauen und Huren anführten, einem reisenden Rummelplatz ähnlich. Aber immerhin marschierten sie jetzt in diesem jahreszeitlich ungewöhnlich feuchten Sommer gen Norden, wo der französische Angriff erfolgen und alle Zweifel und Ängste im Kampf gebannt werden sollten.
Die Straße erreichte eine Anhöhe. Dahinter lag ein flaches Tal mit einem kleinen Dorf in der Mitte. In diesem Dorf befand sich Kavallerie, vermutlich genau wie das South Essex auf dem Weg nach Norden. Als Sharpe der vielen Pferde ansichtig wurde, ließ er seinen Ärger erkennen, indem er auf die Straße spuckte.
Diese verfluchte Kavallerie mit ihrem affektierten Gehabe, ihrer unverblümten Herablassung gegenüber der Infanterie. Dann sah er die Uniformen der abgesessenen Reiter und schämte sich seiner Reaktion. Die Männer trugen das Blau der Deutschen Legion des Königs, und Sharpe hatte Respekt vor den Deutschen. Sie waren Berufssoldaten, und Sharpe war ebenfalls in erster Linie Berufssoldat. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er hatte kein Geld, um sich Beförderung zu erkaufen, und seine Zukunft hing einzig von seinem Können und seiner Erfahrung ab.
Erfahrung hatte er im Überfluss. Siebzehn seiner dreiunddreißig Jahre war er Soldat gewesen, erst als Private, dann als Sergeant. Dann war der Schwindel erregende Sprung in den Offiziersrang erfolgt. Und sämtliche Beförderungen hatte er sich auf dem Schlachtfeld verdient. Er hatte in Flandern gekämpft, in Indien und nun auf der Iberischen Halbinsel. Dabei war er sich darüber im Klaren, dass ihn das Heer, sobald Frieden einkehrte, wie eine glühend heiße Kartoffel fallen lassen würde. Nur in Kriegszeiten wurden Berufssoldaten wie er gebraucht, wie Harper, wie die zähen Deutschen, die in britischen Diensten gegen Frankreich kämpften.
Er ließ die Kompanie auf der Dorfstraße unter den neugierigen Blicken der Kavalleristen haltmachen. Einer von ihnen, ein Offizier, zog den Gurt mit dem Säbel hoch und kam auf Sharpe zu. »Captain?« Der Kavallerist ließ es wie eine Frage klingen, weil Sharpes einzige Rangabzeichen die verblasste scharlachrote Schärpe und sein Degen waren.
Sharpe nickte. »Captain Sharpe, South Essex.«
Der deutsche Offizier zog die Augenbrauen hoch, sein Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. »Captain Sharpe! Talavera!« Er schüttelte Sharpe ausgiebig die Hand, klopfte ihm auf die Schulter, wandte sich dann lautstark an seine Männer. Die blauberockten Kavalleristen grinsten und nickten Sharpe zu. Sie hatten alle von ihm gehört, von dem Mann, der in Talavera den französischen Adler erbeutet...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.