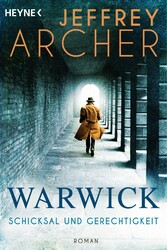Suchen und Finden
1
14. Juli 1979
»Das kann nicht dein Ernst sein.«
»Es gibt nichts, womit es mir jemals ernster gewesen wäre, wie du längst wissen könntest, wenn du mir in den letzten zehn Jahren auch nur ein einziges Mal zugehört hättest.«
»Aber man hat dir einen Platz an meinem alten College in Oxford angeboten. Du kannst Jura studieren, und wenn du deinen Abschluss hast, kannst du als Anwalt arbeiten, genau wie ich. Was könnte ein junger Mann denn noch verlangen?«
»Dass man es ihm überlässt, welchen Beruf er wählen will, und nicht von ihm erwartet, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt.«
»Wäre das denn so schlimm? Schließlich habe ich eine faszinierende Karriere, die vielerlei Nutzen bringt. Und ich darf sogar behaupten, dass ich bisher einigermaßen erfolgreich war.«
»Du warst sogar ganz außerordentlich erfolgreich, Vater, aber es geht hier nicht um deine berufliche Laufbahn, sondern um meine. Vielleicht möchte ich ja kein führender Barrister dieses Landes werden, der sein Leben damit verbringt, einen Haufen Kriminelle vor Gericht zu verteidigen, die er niemals zum Lunch in seinen Club einladen würde.«
»Du hast anscheinend vergessen, dass einige dieser Kriminellen deine Schule bezahlt und dir das Leben ermöglicht haben, das du im Augenblick führst.«
»So etwas kann ich unmöglich vergessen, Vater. Und genau deshalb will ich dafür sorgen, dass diese Kriminellen für lange Zeit hinter Gitter kommen. Ich will verhindern, dass sie sich nur deshalb, weil du als Anwalt so brillant bist, in Freiheit ein Leben aufbauen können, das auf nichts als Verbrechen gründet.«
William war es endlich gelungen, seinen Vater zum Schweigen zu bringen, doch nur für einen kurzen Augenblick.
»Vielleicht könnten wir uns auf einen Kompromiss einigen, mein Junge.«
»Ganz sicher nicht«, sagte William nachdrücklich. »Du hörst dich an wie ein Anwalt, der für eine geringere Strafe eintritt, weil er weiß, dass sein Fall auf wackligen Füßen steht. Doch in dieser Sache trifft deine Eloquenz auf taube Ohren.«
»Willst du mir nicht einmal gestatten, mein Plädoyer vorzutragen, bevor du es beiseitewischst?«, erwiderte Williams Vater.
»Nein, weil ich tatsächlich nicht schuldig im Sinne der Anklage bin. Und es gibt auch keine Geschworenen, denen du, nur weil es dir selbst Vergnügen macht, beweisen wirst, dass ich unschuldig bin.«
»Aber bist du möglicherweise bereit, etwas mir zuliebe zu tun, Liebling?«
Im Eifer des Gefechts hatte William fast vergessen, dass seine Mutter schon die ganze Zeit über am anderen Ende des Tisches saß und die Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Vater genau verfolgt hatte. Es fiel ihm nicht schwer, es mit seinem Vater aufzunehmen, aber er wusste, dass er gegen seine Mutter keine Chance hatte. Er schwieg, und sein Vater nutzte dieses Schweigen.
»Woran haben Eure Lordschaft gedacht?«, fragte Sir Julian, indem er die Aufschläge seiner Jacke umfasste und sich an seine Frau wandte, als sei sie ein Richter am Obersten Gerichtshof.
»William soll das Recht haben, eine Universität seiner Wahl zu besuchen«, sagte Marjorie. »Er soll das Fach studieren, das er studieren möchte, und wenn er seinen Abschluss gemacht hat, soll er sich für den Beruf entscheiden, der ihm liegt. Und was noch wichtiger ist: Wenn er das tut, wirst du großmütig nachgeben und nie wieder auf das Thema zu sprechen kommen.«
»Ich muss gestehen«, sagte Sir Julian, »dass ich dein kluges Urteil akzeptiere, obwohl es mir schwerfällt.«
Mutter und Sohn brachen in Gelächter aus.
»Dürfte ich vielleicht auf eine Abmilderung der Bedingungen plädieren?«, fragte Sir Julian in unschuldigem Ton.
»Nein«, sagte William, »weil ich nur dann auf Mutters Vorschlag eingehen werde, wenn du in drei Jahren ohne Wenn und Aber meine Entscheidung, zur Metropolitan Police Force zu gehen, unterstützen wirst.«
Kronanwalt Baronet Sir Julian Warwick erhob sich von seinem Platz am Kopfende des Tisches, deutete seinem Sohn gegenüber eine Verbeugung an und sagte widerstrebend: »Wenn das der Wunsch Eurer Lordschaft ist.«
William Warwick hatte seit seinem achten Lebensjahr Detective werden wollen; damals hatte er den »Fall der verschwundenen Mars-Riegel« gelöst. Das Papier war der Schlüssel, hatte er dem für seine Hausgruppe verantwortlichen Lehrer an seiner Schule erklärt. Man brauchte dazu nicht einmal ein Vergrößerungsglas.
Die Beweismittel – die Verpackungen der fraglichen Schokoriegel – waren im Papierkorb des Verdächtigen gefunden worden, und Adrian Meath, der unglücklicherweise ein Freund Williams gewesen war, hatte nicht nachweisen können, dass er in jenem Schuljahr überhaupt irgendetwas von seinem Taschengeld im nahe gelegenen Süßwarenladen ausgegeben hatte. Seine Mitschüler, die davon träumten, Ärzte, Anwälte, Lehrer und Buchhalter zu werden, hatten ihn zwar verspottet, doch der für die Berufsberatung zuständige Lehrer war nicht überrascht gewesen, als William ihm mitgeteilt hatte, dass er Detective werden wollte. Schließlich hatten ihm die anderen Jungen noch vor dem Ende des ersten Schuljahres den Spitznamen »Sherlock« gegeben.
Williams Vater, Barrister Sir Julian Warwick, wollte, dass sein Sohn in Oxford Jura studierte, genau wie er selbst es dreißig Jahre zuvor getan hatte. Doch trotz aller Bemühungen seines Vaters war William entschlossen, unmittelbar nach seinem Schulabschluss zur Polizei zu gehen. Die beiden Dickköpfe erreichten schließlich einen Kompromiss: William würde die London University besuchen und Kunstgeschichte studieren – sein Vater weigerte sich, dieses Fach ernst zu nehmen –, und sollte der Sohn nach drei Jahren noch immer Polizist werden wollen, so würde Sir Julian ohne zu murren einwilligen. William wusste jedoch, dass das nie geschehen würde.
William genoss die drei Jahre am King’s College in London, wo er sich mehrmals verliebte. Zuerst in Hannah und Rembrandt, dann in Judy und Turner und danach in Rachel und Hockney. Am Ende jedoch fiel seine Wahl auf Caravaggio, eine Affäre, die sein ganzes Leben lang bestehen sollte, obwohl sein Vater ihn darauf hinwies, dass der große italienische Künstler ein Mörder war, den man hätte hängen sollen. Ein gutes Argument für die Abschaffung der Todesstrafe, hatte William gemeint. Wieder einmal waren Vater und Sohn nicht einer Meinung.
Nachdem William die Schule beendet hatte, war er im Sommer nach Rom, Paris und sogar St. Petersburg gefahren, wo er sich in die langen Warteschlangen anderer Kunstbegeisterter einreihte, die den Meistern der Vergangenheit die Ehre erweisen wollten. Nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte, fragte ihn sein Professor, ob er nicht über die dunklere Seite Caravaggios promovieren wolle. Genau diese dunklere Seite, erwiderte er, wolle er erforschen, doch dabei habe er die Absicht, mehr über Kriminelle des zwanzigsten Jahrhunderts zu erfahren und weniger über die des sechzehnten.
Am Sonntag, dem fünften September 1982, um fünf Minuten vor drei Uhr nachmittags, meldete sich William im Hendon Police College in North London. Von dem Moment an, in dem er den Treueeid auf die Königin ablegte, bis zur Abschlussparade sechzehn Wochen später genoss er fast jede Minute seines Ausbildungskurses.
Am Tag darauf erhielt er eine Uniform aus marineblauer Serge, einen Helm und einen Schlagstock; jedes Mal, wenn er an einem Schaufenster vorbeikam, konnte er nicht widerstehen, einen Blick auf sein Spiegelbild zu werfen. Eine Uniform, warnte ihn sein Kommandant am ersten Tag seiner Ausbildung, konnte den Charakter eines Menschen verändern, und das nicht immer zum Besseren.
Der Unterricht in Hendon hatte am zweiten Tag begonnen und fand teils in Schulungsräumen, teils in der Sporthalle statt. William lernte ganze Abschnitte von Gesetzestexten auswendig, sodass er sie wortwörtlich wiederholen konnte. Forensische Untersuchungen und Tatortanalysen lagen ihm ganz besonders, auch wenn er schnell herausfinden sollte, dass seine Fähigkeiten allenfalls rudimentär waren, als man ihn im Umgang mit Polizeifahrzeugen schulte.
Nachdem er sich jahrelang hitzige Debatten mit seinem Vater am Frühstückstisch geliefert hatte, fiel es ihm leicht, von seinen Vorgesetzten ins Kreuzfeuer genommen zu werden, als er in einer fingierten Gerichtsverhandlung in den Zeugenstand treten musste. Und er behauptete sich sogar im Selbstverteidigungsunterricht, wo er lernte, wie man einen viel größeren Gegner entwaffnete, ihm Handschellen anlegte und mit Gewalt festhielt. Ebenso unterrichtete man ihn in den Rechten eines Constables im Hinblick auf Festnahmen, Durchsuchungen und das Betreten einer Wohnung sowie im Hinblick auf den Gebrauch angemessener Gewalt. Und vor allem brachte man ihm das Wichtigste bei: Diskretion. »Sie sollten sich nicht immer an Ihr Lehrbuch halten«, empfahl ihm sein Ausbilder. »Manchmal sollten Sie Ihren gesunden Menschenverstand benutzen, der, wie Sie noch herausfinden werden, wenn Sie mit der Öffentlichkeit zu tun haben, nicht allzu verbreitet ist.«
Es gab genauso viele Prüfungen wie während seiner Zeit an der Universität, und er war nicht überrascht, dass einige Kandidaten auf der Stecke blieben, bevor der Kurs zu Ende war.
Nach einer schier endlosen Pause von zwei Wochen nach seiner Abschlussparade erhielt William einen Brief, der ihn aufforderte, sich am folgenden Montag um acht Uhr vormittags im Polizeirevier Brixton zu melden. In dieser Gegend Londons war er noch nie zuvor...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.