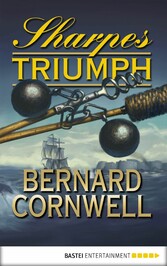Suchen und Finden
KAPITEL 1
Es war zehn Tage vor Maria Lichtmess im Jahre 1814, und der Wind vom Atlantik brachte kalte Regenschauer. Der Regen prasselte auf das Kopfsteinpflaster enger Gassen, strömte aus beschädigten Dachrinnen und trommelte auf das Wasser im Binnenhafen von St. Jean de Luz. Der Winterwind war kalt und schneidend. Er wirbelte den Rauch aus den Schornsteinen in die tief hängenden Wolken, die den Himmel über der südwestlichen Ecke Frankreichs verhüllten, wo sich die britische Army in diesem Januar festgesetzt hatte.
Ein britischer Soldat ritt auf einem erschöpften und schlammbespritzten Pferd über eine Kopfsteinpflasterstraße von St. Jean de Luz. Er duckte sich unter dem hölzernen Schild einer Bäckerei, lenkte seine Stute an einem Fischkarren vorbei und saß an einer Ecke ab, wo er die Zügel seines Pferdes an einem eisernen Poller anband. Er tätschelte das Pferd, schnallte die Satteltaschen ab und warf sie sich über die Schulter. Es war offenkundig, dass er weit geritten war.
Er ging in eine schmale Gasse und suchte ein Haus, das er nur von der Beschreibung her kannte, ein Haus mit blauer Tür und zersprungenen grünen Kacheln über dem Sturz. Er erschauerte in Regen und Kälte. An seiner Hüfte hing ein schwerer Kavalleriesäbel in einer Metallscheide, und über seiner rechten Schulter trug er ein Gewehr. Er machte einer korpulenten, schwarzgekleideten Frau Platz, die einen Korb mit Hummern am Arm hängen hatte. Sie lächelte, dankbar über diese kleine Höflichkeit eines feindlichen Soldaten, doch als sie sicher an ihm vorbei war, bekreuzigte sie sich. Das Gesicht des Soldaten war grimmig und narbig. Es sah auf harte Weise gut aus, aber es war das Gesicht eines tödlichen Kämpfers. Die Frau dankte ihrem Schutzpatron, dass ihr Sohn nicht gegen einen solchen Mann in der Schlacht kämpfen musste, sondern stattdessen eine sichere und gefahrlose Arbeitsstelle beim französischen Zoll hatte.
Der Soldat fand die blaue Tür unter den grünen Kacheln. Obwohl es bitterkalt war, stand die Tür einen Spaltbreit offen. Ohne anzuklopfen trat er ein. In der Diele legte er sein Gepäck und das Gewehr auf dem abgelaufenen Teppich ab und sah sich plötzlich einem Stabsarzt der britischen Army gegenüber, der ihn gereizt anstarrte.
»Ich kenne Sie«, sagte der Stabsarzt, dessen Hemdmanschetten mit getrocknetem Blut bedeckt waren.
»Sharpe, Sir, von den Eigenen Freiwilligen des Prinzen von Wales …«
»Ich sagte, ich kenne Sie«, fiel ihm der Stabsarzt ins Wort. »Ich holte nach der Schlacht bei Fuentes d’Onoro eine Musketenkugel aus Ihnen heraus. War ziemlich mühsam, wie ich mich erinnere.«
»In der Tat.« Sharpe hatte es nur allzu gut in Erinnerung. Der Stabsarzt war halb betrunken gewesen. Im Schein einer flackernden Kerze hatte er die Kugel mehr aus Sharpes Körper herausgewühlt als herausoperiert. Jetzt sahen sich die beiden Männer im Vorzimmer von Lieutenant Colonel Michael Hogans Quartier wieder.
»Sie können da nicht rein.« Die Kleidung des Stabsarztes war zur Vorbeugung mit Essig getränkt, und der Geruch erfüllte die Diele. »Es sei denn, Sie wollen sich den Tod holen.«
»Aber …«
»Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde.« Der Stabsarzt wischte das Gefäß zum Aderlass mit dem Hemdschoß ab und warf es in seine Arzttasche. »Wenn Sie sich das Fieber holen wollen, gehen Sie rein, Major.« Er spuckte auf ein breitklingiges Messer zum Skarifizieren, wischte das Blut davon ab und zuckte mit den Schultern, als Sharpe die Innentür öffnete.
Hogans Zimmer wurde von einem großen Kaminfeuer beheizt, in dem es zischte, wenn Regen durch den Schornstein in die Flammen fiel. Hogan lag im Bett und war mit ein paar Decken zugedeckt. Er fror und schwitzte gleichzeitig. Sein Gesicht war grau und schweißbedeckt, und die Augen waren rot gerändert. Er murmelte etwas Unzusammenhängendes.
»Er fantasiert im Fieber«, sagte der Stabsarzt hinter Sharpe. »Haben Sie dienstlich mit ihm zu tun?«
Sharpe schaute auf den Kranken. »Er ist mein besonderer Freund.« Er wandte sich zu dem Stabsarzt um und sah ihn an. »Ich konnte ihn nicht eher besuchen. Ich wusste, dass er krank ist, aber …« Er fand keine Worte mehr.
Der Stabsarzt wurde etwas freundlicher. »Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas Hoffnung machen, Major.«
»Das können Sie nicht?«
»Er hat vielleicht noch zwei Tage. Vielleicht lebt er auch noch eine Woche.« Der Stabsarzt zog seinen Rock an, den er abgelegt hatte, bevor er Hogan zur Ader gelassen hatte. »Er ist in rotes Flanell eingehüllt, wird regelmäßig geschröpft, und wir haben ihm Schießpulver und Brandy gegeben. Mehr können wir nicht tun, Major, außer beten um Gottes Barmherzigkeit.«
Im Krankenzimmer stank es nach Erbrochenem. Sharpe schwitzte in der Hitze des großen Kaminfeuers. Seine nasse Uniform begann zu dampfen. Er trat näher ans Bett heran, aber Hogan erkannte ihn nicht. Der Ire in mittleren Jahren, Wellingtons Geheimdienstchef, zitterte und schwitzte und stammelte Unzusammenhängendes mit der Stimme, die Sharpe so oft durch den trockenen Humor Hogans belustigt hatte.
»Es ist möglich, dass mit dem nächsten Konvoi etwas Chinarinde kommt«, sagte der Stabsarzt aus der Diele.
»Chinarinde?« Sharpe wandte den Kopf und sah den Arzt fragend an.
»Die Rinde eines südamerikanischen Baums, Major, auch Chinin genannt. Wenn man die richtig verabreicht, kann sie Wunder bewirken. Aber es ist eine seltene Substanz, Major, und wahnsinnig teuer!«
Sharpe trat noch näher ans Bett. »Michael? Michael?«
Hogan sagte etwas auf Gälisch. Sein Blick ging an Sharpe vorbei und flackerte. Er schloss die Augen und öffnete sie wieder.
»Michael?«
»Ducos«, sagte der Kranke deutlich. »Ducos.«
»Er spricht wirres Zeug«, bemerkte der Stabsarzt.
»Soeben aber nicht.« Sharpe hatte klar einen Namen gehört, einen französischen Nachnamen, den Namen eines Feindes, aber Sharpe wusste nicht, in welchem Zusammenhang der Fiebernde den Namen benutzte.
»Der Field Marshal ließ mich holen«, erklärte der Stabsarzt. »Aber ich kann keine Wunder bewirken, Major. Nur der Allmächtige kann das.«
»Oder diese Chinarinde.«
»Die ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen habe.« Der Stabsarzt stand immer noch an der Tür. »Darf ich darauf bestehen, dass Sie jetzt gehen, Major? Gott schütze uns vor einer Ansteckung.«
»Ja.« Sharpe würde sich nie verzeihen, wenn er Hogan nicht eine Geste der Freundschaft erwies, so nutzlos sie auch war, und so neigte er sich zu ihm, nahm die Hand des Kranken und drückte sie leicht.
»Maquereau«, sagte Hogan mit klarer Stimme.
»Maquereau?«
»Major!«, rief der Stabsarzt.
Sharpe gab dem Drängen des Stabsarztes nach und verließ das Zimmer. »Sagt Ihnen maquereau etwas?«
»Das ist ein Fisch. Die Makrele. Damit bezeichnet man in der französischen Umgangssprache auch einen Zuhälter, Major. Ich sagte Ihnen ja, er fantasiert.« Der Stabsarzt schloss die Tür des Krankenzimmers. »Und ich möchte Ihnen noch einen Rat geben, Major.«
»Ja?«
»Wenn Sie wollen, dass Ihre Frau am Leben bleibt, dann sagen Sie ihr, dass sie ihn nicht mehr besuchen soll.«
Sharpe verharrte bei seinem nassen Gepäck. »Jane besucht ihn?«
»Eine Mrs Sharpe besucht den Lieutenant Colonel täglich«, sagte der Stabsarzt, »ihren Vornamen kenne ich nicht. Guten Tag, Major.«
Es war Winter in Frankreich.
Der Boden bestand aus glänzendem Parkett, die Wände waren mit Marmor verkleidet, und die Decke aus Stuck war eine wahre Farbenorgie. Mitten auf dem Boden, unter dem großen Kronleuchter und zwergenhaft klein im Vergleich zu den Proportionen des riesigen Raums, stand ein Tisch aus Malachit. Sechs Kerzen, deren Schein zu schwach war, um die Ecken des großen Zimmers zu erreichen, beleuchteten Landkarten, die auf dem grünen Steintisch ausgebreitet lagen.
Ein Mann ging von dem Malachittisch zum Feuer, das im kunstvoll behauenen Kamin brannte. Er starrte in die Flammen, und als er schließlich sprach, hallten seine Worte dumpf von den Marmorwänden wider. »Es gibt keine Reserven.«
»Calvets halbe Brigade …«
»Ist unverzüglich nach Süden abkommandiert.« Der Mann wandte sich vom Feuer ab und schaute zum Tisch, wo der Kerzenschein auf zwei blasse Gesichter über dunklen Uniformen fiel. »Der Kaiser wird nicht erfreut sein, wenn wir …«
»Der Kaiser belohnt Erfolge«, unterbrach der kleinste Mann mit überraschend tiefer und harter Stimme.
Der Januarregen prasselte gegen die hohen Fenster, die nach Osten wiesen. Die Samtvorhänge dieses Zimmers waren vor einundzwanzig Jahren heruntergerissen worden, Trophäen für einen Revolutionsmob, der triumphierend durch die Straßen von Bordeaux gezogen war, und es hatte weder das Geld noch den Willen gegeben, neue Vorhänge aufzuhängen. Das Resultat war, dass es in solch kalten Wintern schlimm zog. Das Feuer konnte kaum den Kamin erwärmen, geschweige denn den ganzen riesigen Raum, und der Général, der vor den schwachen Flammen stand, fröstelte. »Osten oder Norden, das ist die Frage.«
Das Problem war einfach genug. Die Briten waren in eine kleine Ecke des südlichen Frankreichs einmarschiert, nichts als ein Fußfassen zwischen den südlichen Flüssen und dem Golf von Biskaya, und diese drei Männer rechneten damit, dass die Briten wieder angriffen. Aber würde Feldmarschall Lord Wellington nach Osten oder Norden vorstoßen?
»Wir wissen, dass er nach Norden will«, sagte der kleinste der drei Männer. »Warum sonst sammeln sie Boote?«
»In diesem Fall, mein lieber Ducos, geht es um eine Brücke oder einen Anlegeplatz.« Der Général...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.