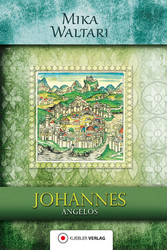Suchen und Finden
Mehr zum Inhalt

Johannes Angelos - Sein Tagebuch von der Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 am Ende des Zeitalters Christi
Dezember 1452
12. Dezember 1452
Ich sah dich zum ersten Mal und sprach mit dir.
Es war, als wäre ein Erdbeben über mich hinweggegangen. Alles wankte in mir, die innersten Gruben meines Herzens brachen auf, und ich kannte mich nicht wieder.
Ich war vierzig Jahre alt und glaubte, nun im Herbst des Lebens zu stehen.
Ich war viel umhergewandert, hatte viel erlebt und viele Leben durchlebt.
Gott hatte in mancherlei Gestalt zu mir gesprochen; Engel waren mir erschienen, aber ich hatte ihnen nicht geglaubt.
Als ich dich sah, glaubte ich, da mir nun ein solches Wunder widerfahren war.
Ich sah dich vor der Sophienkirche, bei den Bronzetoren. Sie kamen alle aus der Kirche heraus, in der vorgeschriebenen zeremoniellen Ordnung, nachdem Kardinal Isidor auf Lateinisch und Griechisch die Vereinigung der Kirchen verkündet hatte. Da herrschte eisige Stille in der Kirche. Sodann leitete er eine glanzvolle Messe und las dabei auch das Glaubensbekenntnis. Als er zu dem Zusatz »und vom Sohne« gekommen war, schlugen viele die Hände vor das Gesicht, und auf den Emporen hörte man die Frauen bitterlich schluchzen. Ich stand in dem Gedränge im Seitenschiff neben einer grauen Säule. Als ich sie mit meiner Hand berührte, spürte ich, dass sie feucht war, so als hätte selbst die steinerne Säule kalten Schmerzensschweiß ausgeschwitzt.
So kamen sie alle aus der Kirche heraus, in der seit Jahrhunderten vorgeschriebenen zeremoniellen Reihenfolge, in ihrer Mitte der Basileus, Kaiser Konstantin, ernst und aufrecht, das schon ergraute Haupt unter den goldenen Bügeln seiner Krone. Sie kamen, und der Kleiderstoff jedes Einzelnen von ihnen, samt jeweiliger Farbe und Schmuck, all das war zeremoniell festgelegt, bei den Beamten vom Palast zu Blachernae, den Ministern, Logotheten und Anthypatoi, allen Senatsmitgliedern und den ihnen folgenden Archonten von Konstantinopel, geordnet nach Herkunft und Geschlecht. Keiner hat es gewagt, demonstrativ nicht zu erscheinen. Zur Rechten des Kaisers ging sein Staatssekretär Sphrantzes, der mit seinen kaltblauen Augen das Volk betrachtete. Ihn kannte ich nur allzu gut. Unter den Lateinern erkannte ich auch den Bailo der Venezianer und so manchen anderen wieder.
Megadux Lukas Notaras, den Großherzog und Befehlshaber der kaiserlichen Flotte, hatte ich bisher noch nicht gesehen. Er war einen Kopf größer als die anderen, ein dunkler und hochmütig auftretender Mann. In seinen Augen blitzte Spott auf, gepaart mit Intelligenz, während sich in seinem Antlitz dieselbe sehnsuchtsvolle Melancholie widerspiegelte, die für die Angehörigen der alten griechischen Geschlechter typisch ist. Als er aus der Kirche trat, machte er einen erhitzten und zornigen Eindruck, so als könnte er die furchtbare Schande nicht ertragen, die seine Kirche und sein Volk nun erleiden mussten.
Die Farben der Gewänder, das griechische Blau und Weiß, die mit Gold und Perlen besetzten Zeremonialmäntel und die verschiedenfarbigen Edelsteine blendeten das Volk. Die Sonne schien, und auf dem Platz vor der Kirche stand das Volk dicht gedrängt. In der Menge waren bärtige, bald verzweifelt, bald grimmig dreinblickende Mönche in ihren schwarzen Gewändern und ihren hohen schwarzen Kapuzen, fanatisierte Handwerker und Kaufleute, Seeleute vom Hafen und Fischer. Aber die meisten waren Mönche. Jeder Dritte, der mir auf den Straßen entgegenkam, war ein Mönch. Schon Hunderte von Kirchen gehörten zu Klöstern, sodass der vom Papst anerkannte Patriarch, Gregorios Mamas, welchen das Volk nur den falschen Patriarchen nannte, eigentlich nur noch über sieben Kirchen gebot.
Als die Reitpferde an den Zügeln herangebracht wurden, entstand ein Tumult; aus dem Volk begannen Rufe zu ertönen, darunter auch Flüche über die Lateiner. »Weg mit den unerlaubten Zusätzen! Nieder mit der Papstherrschaft!«, rief man. Ich wollte nicht hinhören. Das alles hatte ich schon bis zum Überdruss in den Tagen meiner Jugend gehört. Aber die Wut und Verzweiflung des Volkes war wie ein Sturmgewitter und ein Erdbeben. Bis die sangesgeschulten Stimmen der Mönche das Volk dazu brachten, wie aus einer Kehle den einen Ruf liturgieartig zu wiederholen: »Nicht vom Sohne, nicht vom Sohne!« Es war der Tag des heiligen Spyridon von Trimythunt.
Als das Gefolge adeliger Frauen aus der Kirche nach draußen drängte, befand sich ein Teil des kaiserlichen Gefolges bereits mitten unter dem Volk, das, angestachelt vom Takt der Rufe, wogte und gegen das Gefolge andrängte. Nur in unmittelbarer Nähe der heiligen Gestalt des Kaisers war noch freier Raum. Konstantin saß bereits im Sattel, und sein Antlitz war dunkel vor Kummer. Bekleidet war er mit dem goldbestickten Purpurmantel, und an den Füßen trug er die mit dem doppelköpfigen Adler verzierten Purpurstiefel.
So erlebte ich als Augenzeuge die Verwirklichung eines jahrhundertealten Traums: die Vereinigung der östlichen mit der westlichen Kirche, die Unterwerfung der rechtgläubigen orthodoxen Kirche unter die päpstliche Gewalt und die Aufgabe des ursprünglichen, von Zusätzen freien Glaubensbekenntnisses. Dadurch, dass Kardinal Isidor die Vertragsurkunde in der Sophienkirche öffentlich verlas, hatte diese Union nun nach mehr als einem Dutzend Jahren der Verschleppung und Verzögerungstaktik endlich Gültigkeit erlangt. Im Dom von Florenz war sie vierzehn Jahre zuvor auf Griechisch von Metropolit Bessarion, dem hochgewachsenen und rundköpfigen Gelehrten, verlesen worden. Ihn hatte Papst Eugen IV. zum Kardinal erhoben, genauso wie auch Isidor, zum Lohn für beider Verdienste um das schwierige Versöhnungswerk.
Aber das war nun schon vierzehn Jahre her. Damals, am selben Abend noch, hatte ich meine Bücher und Kleider verkauft, mein Geld unter die Armen verteilt und war aus Florenz geflohen. Fünf Jahre später nahm ich das Kreuz. Während nun das Volk lärmte, erinnerte ich mich an die Bergpfade bei Assisi und das Leichenfeld von Warna.
Als die Rufe plötzlich verstummten, blickte ich auf und sah, dass der Megadux Lukas Notaras auf eine Erhöhung vor der gelben Säulenkolonnade sprang. Mit ausgestreckten Armen gebot er dem Volk Ruhe, und der beißende Dezemberwind trug mir seinen lauten Ruf ans Ohr: Lieber den türkischen Turban als die päpstliche Mitra!
Als das Volk und die Mönche diese trotzige Losung hörten, brach alles in frenetische Jubelrufe aus. Das griechische Volk von Konstantinopel schrie und brüllte triumphierend: Lieber den türkischen Turban als die päpstliche Mitra! Auf die gleiche Art hatten einst die Juden gerufen: Nicht diesen, sondern Barabbas!
Eine ganze Reihe Adeliger und Archonten aus dem Zeremonialgefolge scharte sich demonstrativ um Lukas Notaras und bezeugte damit, dass sie diesen unterstützten und offen dem Kaiser trotzten. Schließlich wich das Volk zurück, und der Kaiser konnte sich mit seinem kleiner gewordenen Gefolge entfernen. Das Gefolge der adeligen Frauen drängte noch immer durch das riesige Bronzetor zur Kirche heraus, löste sich aber sofort auf dem Platz in der lärmenden Volksmenge auf.
Besonders gespannt war ich darauf, wie das Volk Kardinal Isidor empfangen würde, der ja selbst Grieche war und wegen der Union schon so mancherlei Ungemach auszustehen gehabt hatte, – wohl deshalb kam er gar nicht erst aus der Kirche heraus. Die Kardinalswürde hatte ihn nicht gerade beleibter werden lassen. Er war derselbe kleine Mann mit den pfefferfarbigen Augen und schien magerer als früher, seitdem er sich nach Art der Lateiner den Bart abrasiert hatte. Aus Ferrara und Florenz hatte ich ihn noch mit Bart in Erinnerung. Die Aufgabe eines Vermittlers ist gewiss nicht leicht. Markos Eugenikos hatte ihn verflucht und behauptet, er habe aus Kiew die Pest nach Ferrara eingeschleppt. Jedenfalls waren dort alle seine Diener an der Pest gestorben. Markos Eugenikos betrachtete das als Strafe Gottes für Isidors Verrat.
Wirr wogten die wütenden Volksmassen auf dem Platz im Schatten der mächtigen Kuppel der Sophienkirche. Im schwarzen Meer der Mönchskapuzen blinkten hier und da die farbigen Seidenmäntel und der Kopfschmuck adeliger Frauen auf, die in dem Gewühl umherirrten. Der Himmel war kalt und von bleicher Bläue, obgleich die Sonne schien.
»Lieber den türkischen Turban als die päpstliche Mitra!« Aufrichtig, aus der Fülle seines Herzens heraus, hatte Großherzog Notaras dies wohl gerufen, aus Liebe zu seiner Stadt und zu seinem Glauben, aus Hass gegen die Lateiner.
Aber auch wenn dieses sein Wort noch so ehrlich gemeint war, so entsprang es für mich doch nur kaltblütiger politischer Berechnung. Im Angesicht der aufmüpfigen Massen legte er seine Karten offen auf den Tisch, um von der Mehrheit des Volkes Unterstützung zu erhalten. Im Grunde seines Herzens vermag kein Grieche die Union gutzuheißen, nicht einmal der Kaiser. Ihm bleibt nur nichts anderes übrig, als sich zu unterwerfen und die Union ausrufen zu lassen, damit der sich daraus ergebende Freundschafts- und Beistandspakt in Kraft treten kann. Dieser verpflichtet den Papst, bei drohender Gefahr seine Flotte zum Schutz Konstantinopels zu entsenden.
Die päpstliche Flotte wird bereits in Venedig ausgerüstet. Kardinal Isidor versichert, sie werde sofort in See stechen und Konstantinopel Rettung bringen, sobald die Nachricht von der Verkündigung der Union bis nach Rom gedrungen sei. Aber seinem Kaiser...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.