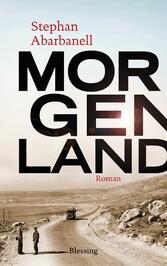Suchen und Finden
1
Sie hob den Kopf und streckte sich. Seit die Festung von Latrun hinter ihnen lag, blickte sie aus dem Fenster. Am Straßenrand kauerten zerschossene Jeeps, daneben stand ein ausgebrannter Lastwagen mit weit geöffneten Türen. An der Böschung entdeckte sie Reifenfetzen und stumpfes Metall, das sie für Geschosshülsen hielt. Die Küste tief unten im Tal war kaum mehr als ein dünner, wie mit Bleistift gezogener Strich. Dahinter erstreckte sich das Meer, das in seiner trügerischen Unendlichkeit so gar nicht zu dem kargen Streifen Land passen wollte, der unter der flimmernden Hitze zu schlafen schien, als läge er im Frieden.
Der Bus kroch zitternd die Straße hinauf, nahm Kurve um Kurve, wie Gewehrschüsse sprangen Steine unter seinem Reifen weg, durch sein Rückfenster war nichts zu sehen als eine Wolke aus Staub und Gestein.
Sie blickte von ihrem Sitz in der letzten Reihe über die Köpfe der Mitreisenden hinweg, sah Hüte, durchgescheuerte Hemdkragen, und in den Gepäcknetzen Koffer mit Aufklebern aus Rotterdam, Marseille, Valparaiso und Hamburg. Es roch nach Kampfer, schal gewordenem Eau de Cologne, Schweiß. Und Angst.
Es dämmerte bereits, als der Wagen an einer Senke zwischen Deir Ajub und Bab el-Wad hielt. Der Fahrer schlug mit der flachen Hand aufs Lenkrad, sprang von seinem Sitz und griff nach einem Kanister mit Wasser. Er riss die Haube des Dodge auf und versuchte mit einem Taschentuch den zischenden Kühler zu öffnen. Keiner der Reisenden sprach ein Wort. Nur das Geräusch von fächelnden Zeitungen und das Zirpen der Grillen durchbrachen die Stille. Fliegen hatten den Weg durch die geöffnete Tür gefunden und die Hitze, die sich in diesen Junitagen von der Erde zu lösen schien, als würde sie zu einem eigenständigen, körperlosen Wesen.
Sie blickte den Abhang hinauf und suchte die Felsen ab, das Gestrüpp, die wie Sterbende sich krümmenden Bäume. Schweiß lief ihr an den Schläfen herunter, sie umfasste mit der einen Hand ihre Haare und band sie mit einem ledernen Riemen zusammen. Dann griff sie wieder nach der Mütze, die sie auf den Schoß gelegt hatte. In der Ferne auf dem Kamm entdeckte sie einen Hirten mit seinem Sohn. Ein dürrer Hund mit fehlfarbenem Fell schlich um sie herum. Hirten waren Späher, hatte man ihr in der Ausbildung gesagt. Behalte sie im Blick, sie nutzen sie für ihre Zwecke.
Wenige Meter darunter, hinter einer aus Felssteinen aufgeschichteten Mauer, befand sich ein britischer Posten, immerhin. Aber bei einem Angriff wären die Engländer kaum rechtzeitig hier. Der erste Schuss, sie würden ihn dort oben kaum hören; beim zweiten würden sie aufwachen, beim dritten hätte endlich ein verschlafener Sergeant den Feldstecher hervorgefingert. Scharfstellen, Gucken. Warum war der Bus dort unten stehen geblieben? Dann der vierte Schuss, fünf, sechs, sieben. Welcher würde ihr gelten?
Die britischen Soldaten würden mit dem Karabiner im Anschlag ausrücken und den Abhang herunterkommen. Und nur noch die Toten zählen.
»Ein Leck im Kühler oder der Radiator. Egged sollte unsere Busse besser warten. Aber es fehlt ihnen das Geld. Und die Geduld.«
Der Mann saß neben ihr und hatte bis eben noch geschlafen. Er mochte ein wenig älter sein als sie, sie schätzte ihn auf Mitte zwanzig, und musste irgendwann zugestiegen sein.
»Ein paar weniger Waffen in den Händen der falschen Leute wären mir auch recht«, sagte sie und blickte wieder den Abhang hinauf.
»In Händen der Araber«, sagte er. »Und? Hast du da oben etwas entdeckt, Genossin, von dem auch ich wissen sollte?«
Nichts war zu sehen. Auch der Hirte war hinter der Kuppe verschwunden.
»Wir bräuchten einen Plan, wie wir aus diesem Gefährt wieder ein bewegliches Ziel machen könnten. Und zwar schnell«, sagte sie.
»Einen Plan. Gute Idee.«
Der Mann lächelte. Er hatte sie »Genossin« genannt.
Sie hatte ihn bislang nicht beachtet. Als der Bus am Carmel-Markt in Tel Aviv gehalten hatte und sie zugestiegen war, hatte sie die unbesetzte Reihe entdeckt und sich ausgebreitet: Rucksack, Mütze, eine Blechflasche mit Wasser, ein Buch aus der Kibbuzbibliothek. Alles war auf einmal so schnell gegangen. Hinter Petach Tikwa waren ihr die Augen zugefallen. Hatte sie geschlafen? Durch die geschlossenen Augen hatte sie Licht gesehen, ein Flackern, wie ferne Leuchtzeichen, bei einem Gangwechsel war ihr Kopf gegen die Scheibe gestoßen.
Der Mann erhob sich, ging nach vorne und stieg aus. Durch die Frontscheibe sah sie, wie er mit dem Fahrer sprach, der, die Hände in die Seiten gestützt, vor der geöffneten Motorhaube stand. Der Fremde zog das Hemd aus der Hose, wickelte den Stoff um seine Hand und öffnete mit schnellem Griff den Kühler. Mit der anderen nahm er den Kanister. Kurz darauf sprang der Motor an. Der Bus setzte sich in Bewegung. Fahrtwind kam durch die Fenster, einer der Passagiere murmelte ein Gebet. Der Fremde setzte sich wieder neben sie. Er hatte helle Zähne, einen dunklen, wüsten Schopf und ein schönes Profil. Er strich sich die nassen Haare aus der Stirn und rieb sich an der Hose die Hände ab.
»Shaul Avidan«, sagte er, »ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich hoffe, es war in Ordnung, dass ich dich einen Moment allein gelassen habe – mit unserem Plan.«
»Ich denke, und der Mann schraubt. So ähnlich hatte ich es mir gedacht«, sagte sie.
Der Fremde lachte.
»Und wie heißt die große Denkerin?«
»Lilya«, sagte sie und reichte ihm die Hand.
»Lilya, und weiter?«
»Wasserfall.«
Er betrachtete sie, als wartete er noch auf etwas. Wie oft hatte sie das erlebt? Bist du keine Hebräerin, keine von uns, würde er jetzt denken, keine mit einem richtigen Namen?
Sie seufzte.
»Lilya Tova Wasserfall.«
Er lächelte.
»Schöner Name. Passt.«
»Danke«, sagte sie.
Er blickte auf ihren Schoß. Erst jetzt merkte sie, dass sie die Mütze noch immer fest umklammert hielt. Sie versuchte die dunklen Flecken, fast schwarz waren sie, zu verdecken. Es war offensichtlich, dass es kein Schweiß war. Er zog ein sauberes, ordentlich gefaltetes Taschentuch aus der Hosentasche und reichte es ihr. Sie bedankte sich, drückte es an Stirn und Schläfen, dann rieb sie sich Hals und Haaransatz ab. Er schien sie dabei zu beobachten, nicht mit dem sehnsüchtigen, oft gierigen Blick, den sie von Männern kannte, eher neugierig und mit einer Art sachlichem Interesse, als wolle er prüfen, ob das Tuch seinen Dienst tat.
Der Bus nahm eine Gerade, die Steigung war jetzt sanfter, immer wieder drehte der Fahrer den Kopf zur Seite, beugte sich mit dem Oberkörper vor und lauschte dem Motor.
»Und nun raus aus der Ackerfurche und hinauf in die heilige Stadt? Du kennst Jerusalem?«, fragte er und ließ das Tuch wieder in der Hosentasche verschwinden.
»Durchaus.«
»Wie wär’s mit einem kleinen Rundgang, Genossin, und wir unterhalten uns ein wenig? Du wirst staunen, wie unsere Stadt trotz all der Gewalt wächst. Es gleicht einem Wunder.«
»Wunder sind etwas Schönes. Nur geschehen sie meist nicht da, wo man sie erhofft. Bis auf wenige Ausnahmen vielleicht …« Lilya versuchte ihrer Stimme Leichtigkeit zu geben.
»Danke«, sagte der Fremde und lächelte.
Sie hatte es sehr wohl bemerkt, er hatte unsere Stadt gesagt, obwohl es doch nicht stimmte. Irgendwann, auch am Ende ihres Weges, würde es niemals nur ihre Stadt sein.
Der Fremde wandte sich ihr wieder zu und blickte auf ihre Stiefel, die voller Erde und Dreck waren.
»Die Idiotie des Landlebens. Geschichte wird in den Städten geschrieben. Wir scheinen das manchmal zu vergessen.«
»Karl Marx«, sagte sie. »Nur hatte der, soweit ich mich erinnere, nicht unsere Kibbuzim im Sinn, als er von der Unbildung der Landleute sprach.«
Der Mann formte mit dem Mund ein stummes »O!«
»Aber hätte er diesen Hort der Zukunft gekannt …«
»… hätte die Weltgeschichte einen völlig anderen Verlauf genommen«, ergänzte sie, »und Stalin wäre heute Bananenpflücker in Ashkelon.«
Sie wusste nicht, was sie von diesem Shaul halten sollte; es gefiel ihr, mit ihm zu reden, sich ablenken zu lassen. Sie hätte das Gespräch gerne fortgesetzt, sich treiben lassen – Gedanken, Sätze, schwerelos wie der Wind dort oben über der Kuppe – und spürte zugleich, wie viel Anstrengung es sie kostete. Sie blickte wieder zum Fenster hinaus, die Sonne war fast gänzlich verschwunden. Zwischen den Hügeln tauchten die ersten Häuser auf, schwarz und schattenlos. Es war nicht mehr weit bis in die Stadt.
Der Mann sah wieder nach vorn. Sie versuchte einen Blick auf seine Hände zu erhaschen. Seit sie mit dem lebte, was sie mittlerweile ihren »Zustand« nannte, betrachtete sie Hände. Die Hände Fremder. Die Hände Shimon Ben Gedis, den sie in Tel Aviv aufgesucht hatte, die Hände des Busfahrers, die Hände des Mannes, der ihr angeboten hatte, den Rucksack in den Wagen zu tragen.
Der Bus wurde langsamer, der Fahrer hielt das Lenkrad mit gestrecktem Arm und zog es kraftvoll nach rechts, sie bogen in den Busbahnhof ein. Schon erhoben sich die Leute, zerrten an Koffern und Taschen, schoben, drängelten, wurden durch das Schaukeln des noch immer rollenden Fahrzeugs hin und her geworfen....
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.