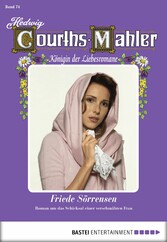Suchen und Finden
Friede Sörrensen stand neben dem Tor, das aus dem Hof der großen Molkerei ins Freie führte. Sie ließ die Milchwagen an sich vorüberfahren. Als der letzte Wagen hinaus war, sprang ein Knecht herbei, um das Tor zu schließen. Friede Sörrensen steckte befriedigt das bereitgehaltene Notizbuch in eine Ledertasche, die am Gürtel ihres einfachen, aber tadellos sitzenden grauen Leinenkleides befestigt war.
Dann betrat Friede Sörrensen das Wohnhaus. Es war ein schlichtes, zweistöckiges Gebäude. Der Hausflur war mit Steinfliesen belegt.
Friede öffnete rechter Hand eine Tür. Sie führte zur Küche, einem großen, blitzblank gehaltenen Raum. Hier saßen ein paar Mädchen und putzten Gemüse. Am großen Anrichtetisch zwischen den Fenstern stand eine ältere, grauhaarige Frau.
„Jetzt kannst du mir mein Frühstück in die Laube schicken, Mutter Triebsch“, rief ihr Friede zu.
Mutter Triebsch war ein Zwischending zwischen Köchin und Haushälterin. Sie war schon in Friede Sörrensens Diensten, bevor diese vor nahezu zwanzig Jahren die damals sehr kleine Molkerei gekauft hatte. Schon damals war sie eine angehende Dreißigerin gewesen, aber sie nahm es noch heute mit der Jüngsten auf, so hurtig versah sie ihr Amt. Neben Friede war sie eine Art Vorgesetzte in der Sörrensenschen Molkerei.
Sie wandte jetzt der Herrin ihr frisches, immer vergnügtes Gesicht zu. „Soll gleich geschehen, Fräulein Sörrensen, gehen Sie man schon immer hinaus. Ist ein rechter Gottesmorgen heute.“
„Ja, Mutter Triebsch, das gibt gutes Heu. Du vergisst doch nicht, den Leuten Kaffee auf die Wiesen zu schicken?“
„I wo werd’ ich das vergessen! Gehen Sie man ruhig in die Laube. Ihre Zeitungen hab ich schon rausgelegt.“
„Schön, Mutter Triebsch.“ Friede Sörrensen zog die Küchentür ins Schloss und verließ das Haus durch die entgegengesetzte Tür.
Hier lag ein großer, mit Schatten spendenden Bäumen bepflanzter Garten, unter denen weißlackierte Tische und Stühle aufgestellt waren. Einige junge Mädchen, alle in dunkelblauen Waschkleidern mit weißen Schürzen, waren eben damit beschäftigt, die Tische mit bunten Leinentüchern zu bedecken. Friede warf, während sie zwischen den Tischen hindurch dem hinteren Teil des Gartens zuschritt, einen Blick auf ihre Uhr.
„Tummelt euch, Mädels! In zehn Minuten kommen die ersten Gäste“, rief sie den Mädchen zu. Und dann blickte sie nach dem Haus zurück.
Rechts und links vom Wohnhaus erstreckten sich bis in den Garten hinein überdachte Hallen. Dort standen weiß gescheuerte Tische, mit großen Körben voll Weißbrot und Zwieback und langen Reihen blitzender Gläser besetzt. Durch eine Stalltür wurden eben die ersten Milchkübel herausgebracht und auf breite Bänke neben den Tischen gesetzt. Auf Brettergerüsten wurden Satten mit dicker Milch aufgestellt.
Überall herrschte reges Leben und Treiben. In den Ställen wurde noch fleißig gemolken. Nachdem der Bedarf für die Kundschaft in der Stadt in den Milchwagen verstaut war, wurde jetzt noch für die Gäste gemolken, die in dem Sörrensenschen Molkereigarten eine Milchkur machten und sie mit einem Morgen- und Abendspaziergang verbinden wollten. Aus allen Schichten der Bevölkerung kamen Damen und Herren jeden Morgen um sechs Uhr durch den schattigen Stadtwald nach der reizend gelegenen Molkerei, um sich an frischer Luft und der rühmlichst bekannten guten Milch und dem knusprigen Weißbrot zu laben. Selbst die Offiziere der Garnison verschmähten es nicht, in dem schattigen Garten auszuruhen und ein Glas Milch zu sich zu nehmen, wenn sie vom Exerzierplatz oder der Reitbahn nach der hinter dem Wald gelegenen Kaserne zurückkehrten. Friede Sörrensen gehörte selbst zur besten Gesellschaft der Garnisonsstadt und war eine sehr beliebte Persönlichkeit. Es ging etwas Frisches, Lebenskräftiges von ihr aus.
Niemand fiel es ein, daran zu denken, dass Friede Sörrensen eine „alte Jungfer“ war. Sie machte auch durchaus nicht den Eindruck einer solchen. Es lag in ihrem ausgeglichenen, zielbewussten Wesen etwas Frauliches. Und ihr angenehmes Gesicht bestrickte durch einen herzlichen, fast mütterlichen Ausdruck.
Wer Friede Sörrensen jedoch zuweilen in Stunden stiller Einsamkeit hätte belauschen können, der hätte etwas in den klugen Augen gesehen, das nicht zu ihrem sonstigen Wesen zu passen schien. Es lag dann etwas Verlorenes, Trauriges in ihrem Blick, etwas wie Sehnsucht nach einem Glück, das ihr unerreichbar geblieben war.
Friede Sörrensens Vater war ein sehr reicher Mann gewesen, als ihre Mutter starb. Damals zählte sie erst drei Jahre. Zwei Jahre später hatte Friede bereits eine Stiefmutter, und diese Frau, ein oberflächliches, verschwenderisches Geschöpf, wurde dem Vater zum Verhängnis. Um die anspruchsvollen Launen seiner zweiten Frau befriedigen zu können, ließ er sich in gewagte Unternehmungen ein. Das alte Lied: ein Leben im großen Stil, Glanz und Fülle nach außen, und heimlich ein verzweifeltes Ringen, den entschwindenden Reichtum festzuhalten. In diesem Treiben wuchs Friede mit ihrer um mehr als fünf Jahre jüngeren Stiefschwester Lizzi auf, fast ganz der Dienerschaft überlassen. Friedes tief angelegte Natur erhielt dadurch etwas Ernstes, Stilles und früh Selbstständiges, während ihre jüngere Schwester, die ganz den leichtfertigen Sinn ihrer Mutter geerbt hatte, sich zu einem oberflächlichen, berechnenden und ziemlich herzlosen Geschöpf auswuchs. Lizzi trat sehr bald in die Fußstapfen ihrer verschwenderischen Mutter. Sie war anspruchsvoll und drängte die stille, bescheidene Friede umso leichter in den Hintergrund, als sie ein blendend schönes Geschöpf war und sich durch ihr einschmeichelndes Wesen alle Vorteile zunutze zu machen wusste.
Von dem heimlichen Verfall im Vaterhaus merkten weder die Schwestern noch die Hausfrau etwas. Sie ahnten nicht, welche verzweifelten Kämpfe es den Gatten und Vater kostete, den Schein des Reichtums aufrechtzuerhalten.
Lizzi kam gleich ihrer Schwester mit sechzehn Jahren in eine vornehme Erziehungsanstalt. Während ihrer Abwesenheit lernte Friede einen jungen Offizier kennen, der ihr, weil seine ernste, stille Art der ihren ähnlich war, bald sehr teuer wurde. Ein halbes Jahr später war sie Fritz von Steinachs glückselige Braut. Steinbach war arm. Trotzdem willigte Friedes Vater in die Verlobung. Er hoffte, dadurch seinen bereits etwas wankenden Kredit zu befestigen. Es musste den Leuten einleuchten, dass seine Verhältnisse noch immer glänzend waren, wenn er einen armen Offizier als Schwiegersohn annahm. Friede verlebte ein Vierteljahr lang eine wundervolle Brautzeit. Sich ganz eins fühlend mit dem Verlobten, erblühte sie wie eine Blume im Sonnenschein. Fritz von Steinbach erkannte gerührt, welche Macht er über dieses sonst so starke, selbstständige Mädchen besaß, und sein Gefühl für sie nahm täglich zu an Wärme und Tiefe.
Und doch verriet er sie.
Ein Vierteljahr nach Friedes Verlobung kam ihre Schwester Lizzi nach Hause zurück. Sie war noch schöner, noch reizender geworden, und aus ihren großen, dunklen Augen strahlte ein süßer verlockender Zauber. Diese Augen verrieten nicht, welch kleine, niedrige Seele in ihr lebte.
Von dem Augenblick an, da Lizzi dem hübschen, stattlichen Verlobten ihrer Schwester entgegentrat und ihn mit ihren schönen, lockenden Augen anstrahlte, war es wie ein feiner Riss zwischen die beiden Verlobten hindurchgegangen.
Lizzi hatte es nicht vertragen können, dass Friede etwas besaß, worauf sie keinen Anspruch hatte. Es reizte sie, ihre Macht an Fritz von Steinbach zu erproben. Mit allen Künsten der Berechnung umwarb sie ihn, stellte Friede in den Schatten und verwirrte mit ihren heiß blickenden Augen die Sinne des Mannes, der ihre Schwester liebte.
Friede stand hilflos dabei und zog sich stolz und herb in sich selbst zurück. Niemand sollte sehen, wie sie litt unter diesem Treiben der Schwester. Sie schämte sich auch ihrer erwachten Eifersucht, und statt den Kampf aufzunehmen und ihr Eigentum zu verteidigen, ließ sie eine lähmende Angst über sich Herr werden.
Und eines Tages, als sie unvermutet ins Zimmer trat, fand sie Lizzi und Fritz in leidenschaftlicher Umarmung.
Sie schrie nicht auf, sprach kein Wort – nur totenbleich wurde sie und ging aus dem Zimmer.
Steinbach starrte ihr nach, wie aus einem Traum erwacht, schuldbewusst, zerknirscht und ernüchtert. Nie hatte er deutlicher gefühlt wie in dieser Stunde, dass sein Bestes – seine Seele – Friede gehörte und dass nichts ihn an Lizzi fesselte als die durch ihr berechnetes Spiel aufgereizten Sinne. Noch in derselben Stunde erzwang er sich eine Aussprache mit Friede. Aber all seinen Bitten und Beschwörungen gegenüber blieb sie starr und kalt. Sie zog den Ring vom Finger und löste ihre Verlobung, weil sie das Vertrauen zu ihm verloren hatte. Sie war noch so jung und unerfahren und wusste nichts vom Leben; sie kannte nicht die Widersprüche im Wesen eines Mannes, ahnte nicht, dass Sinne und Herz verschiedene Sprachen reden können.
Sie hielt sich an die mit eigenen Augen entdeckte Untreue und wies ihren Verlobten mit wenigen, heiseren Worten der Schwester zu.
Als er erschüttert von ihr ging, brach sie zusammen wie ein gefällter Baum.
Am anderen Morgen reiste Friede, nach einer kurzen Aussprache mit dem Vater, zu einer verwitweten Schwester ihrer verstorbenen Mutter. Kurze Zeit darauf verlobte sich Fritz von Steinbach mit Lizzi, und nach kurzer Brautzeit wurde sie seine Frau.
Friede kehrte nicht nach Hause zurück. Bei ihrer Tante hatte sie die liebevollste Aufnahme gefunden. Die alte Dame war kinderlos und...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.