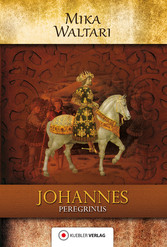Suchen und Finden
Mehr zum Inhalt

Johannes Peregrinus - Der junge Johannes. Historischer Roman. Deutsche Erstveröffentlichung
Kapitel II
Der Herbst und Winter, den ich in Basel verlebte, war das Fegefeuer meines Lebens. Von den Schreibern des Kardinals Cesarini war ich der Ungelernteste und Jüngste, und das bekam ich schmerzlich zu spüren. In der Schreibstube wies man mir den Platz an der Tür zu, und die niedrigsten Aufgaben wurden mir übertragen. Wie Wölfe stellten mir die älteren Schreiber nach, und hatte sich das Auge des Vorgesetzten erst einmal abgewandt, wurden sie frech und vorlaut. Als ich kam, sahen sie in mir einen Nebenbuhler um die Gunst des Kardinals und setzten alles daran, dass ich keine Aufgaben zugewiesen bekam, bei denen ich meine Fähigkeiten hätte beweisen können. Auch verhinderten sie, dass ich dem Kardinal vor die Augen treten und ihm meine Dienste antragen konnte. Ich taugte für sie nur dann, wenn ich, um ihnen gefügig zu sein und ihren Quälereien zu entgehen, ihnen als Laufbursche eine Kanne Wein aus der Schenke holte. Aber auch dann hänselten sie mich, weil ich nicht mittrinken wollte.
Ich hatte eine gute Handschrift und machte beim Kopieren lateinischer Briefe auch keine Fehler. Das konnten sie mir nicht verzeihen, denn einige von ihnen hatten an der Universität studiert. Um ihre eigene Dummheit zu verschleiern, nutzten sie meine Unwissenheit in der Theologie und im kanonischen Recht aus und analysierten untereinander die Beschlüsse und Dekrete des heiligen Konzils, so als wären sie selber von höchster Gelehrsamkeit. Ich fand, dass sie die Zeit mit dummen und nutzlosen Fragen vertaten, so dass sie selber nicht mehr begriffen, was das Konzil eigentlich war und was darauf wirklich vor sich ging.
Denn das Konzil war, wie ich fand, durchaus nicht heilig, auch wenn es von der Voraussetzung ausging, dass der Heilige Geist die Ergebnisse seiner Abstimmungen beeinflusste und es somit die höchste Autorität in der Kirche vertrete, der sich sogar der Papst unterzuordnen habe. Wenn die Stadt Basel sich dadurch bereicherte, dass sie die Kardinäle, Bischöfe und Prälaten, Juristen und Priester des Konzils als ihre Gäste aushielt, so vergrößerte sie meiner Meinung nach ihren Reichtum vor allem durch den unbegreiflichen Weinkonsum und die genauso ungeheure Papierverschwendung. Wollte ich reich werden, so sagte ich mir verbittert, träte ich als Gehilfe in eine Weinhandlung ein, betriebe eine Papiermühle oder würde mich als Türwärter eines Freudenhauses verdingen. Jene Männer, die – gewiss mit guten Absichten und Vorsätzen – zusammengekommen waren, unter der Führung des Heiligen Geistes die heilige Kirche zu reformieren, hatten schon längst den Gedanken aufgegeben, damit zuallererst bei sich selbst anzufangen. Sie waren angesteckt von einer geistigen Pest, der leidenschaftlichen Jagd nach Erfolg, Würden und Ehrenplätzen. Und wenn sie dann außer auf ihren persönlichen Vorteil noch auf etwas anderes bedacht waren, dann war es die Sache des eigenen Volkes, Königs oder Fürsten, die sie vertraten. Unter jenen fünf- bis sechshundert Konzilsvätern gab es so viele Meinungen wie Männer, und die Stimme eines einfachen Priesters oder Laien hatte bei den Abstimmungen das gleiche Gewicht wie die eines Bischofs oder Kardinals. Verstandesschärfe, Gelehrsamkeit, Argumente weiser Männer – das alles kümmerte sie nicht mehr, dagegen errangen am meisten Zustimmung jene, die am lautesten schrien. Mir kam es vor, als wären in den nebeligen Wintertagen Basels Gassen in einen Raureif aus Hass und Schmähungen getaucht.
Aber – so dachte ich – es waren in Basel ja auch die gelehrtesten Männer ihrer Zeit versammelt, Schüler Vergils und Ciceros, die den Nebel der Zeit aufzureißen vermochten, indem sie der Sonne, die von den Dichtern der Antike, von Rom und Griechenland ausging, zu neuem Aufstrahlen verhalfen. Nach ihrer Gesellschaft ging mein Verlangen, ihretwegen war ich nach Basel gekommen. Und der Berühmteste von ihnen war Äneas Sylvius, der Orator und Dichter. Um ihn herum hatte sich eine kleine »Akademie von Basel« gebildet, wie sich diese Vereinigung selbst nannte. Auf deren abendlichen Sitzungen glänzte er mit Geist und Scharfsinn, so sagte man. Und obwohl auch er nur im Range eines Sekretärs des Kardinals vom Heiligen Kreuz stand, konnte ich mir nicht vorstellen, wie es mir als Geringstem unter Kardinal Cesarinis Sekretären gelingen sollte, diesem Manne einmal zu Füßen zu sitzen und seinen Vorträgen zu lauschen. Wenn ich auch hohe Achtung vor den Kardinälen und Bischöfen hatte, so verehrte ich noch viel mehr die gleichsam in die Wolken ragende Gestalt jenes Äneas Sylvius.
So manches Mal schlich ich um seine Wohnung und sah ihn sogar, meist inmitten heiterer Gesellschaft, aber ob meiner Jugend und Schüchternheit wagte ich ihn nicht anzusprechen. In der Schreibstube lästerte man über ihn, aber ich wollte und konnte nichts Übles von diesem Dichter denken. Für mich waren diese Verleumdungen nur missgünstiges Gerede von Schwarzröcken, die sich in den Netzen theologischer Fangfragen verfangen hatten. »Greif dir eine Kanne Wein und schlepp ihm ein hübsches Mädchen an«, rieten sie mir spöttisch, »dann kannst du seiner Gunst sicher sein, solange der Wein nicht versiegt, und für das Mädchen wird er sich sogleich einen lateinischen Namen ausdenken.«
Wäre ich älter und reicher gewesen, hätte ich diesen Rat möglicherweise ernsthaft in Erwägung gezogen, denn während des Konzils gab es in Basel keinen Mangel an hübschen und leichtsinnigen Mädchen. Doch in meiner Unerfahrenheit hielt ich diesen Rat nur für boshaften Spott. Schließlich half mir ein Zufall. Ich wurde losgeschickt, um ihm eine Einladung für ein Abendessen beim Kardinal zu überbringen, denn auch sonst übertrug man mir die Aufgaben eines Dieners und Laufburschen. Ihm stand ein eigenes Zimmer in einem Bürgerhaus zur Verfügung, und das war ein großer Luxus, da es in der Stadt wegen der zahllosen Gäste recht eng geworden war. Ich klopfte an die Tür, und eine matte Stimme hieß mich eintreten. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, doch der Dichter lag noch immer im Bett.
»Schließ die Tür lautlos hinter dir«, sagte er mit heiserer Stimme. »Mach keinen Krach und sprich leise, was du vorzubringen hast, denn mein Kopf will mir schier zerplatzen.«
In seinem Zimmer lagen kreuz und quer zerstreut allerlei Bücher und Papiere. Auf dem Tisch standen leere Becher, und auf dem Fußboden sah ich ein vollgeschriebenes Blatt Papier liegen, auf dem ein schmutziger Schuh seinen Abdruck hinterlassen hatte. Auch in diesem jämmerlichen Zustand war Äneas Sylvius ein schöner Mann. Er hatte große leuchtende Augen, einen fülligen Mund und eine ebenmäßige Nase.
»Seid Ihr krank?« fragte ich besorgt.
»Mich quält starker Rheumatismus«, sagte er. »Würde in irgendeinem mitleidsvollen Menschen noch ein winziger Rest christlicher Nächstenliebe in dieser Welt voller Bestien und Hinterlist stecken, so griffe er nach dem Geldbeutel unter meinem Kopfkissen, nähme Geld heraus und liefe in die Schenke, um mir dort ein kleines Maß italienischen Weines zu kaufen. Die Schenke ist nicht zu verfehlen, sie liegt beinahe gegenüber, und über der Tür hängt ein Bund Stroh.«
Ich fingerte nach dem Geldbeutel unter seinem Kopfkissen, aber der war leer. Er war ziemlich überrascht und sagte: »Ist der Welten Lohn so gering, werden Dichter so knauserig entlohnt, obgleich ich im Handumdrehen eine Elegie im Stile Tibulls schreibe oder eine lange Epistel nach Art des Horaz oder auch eine Satire, die Juvenal übertrifft? Dann sieh mal nach der Kanne auf dem Tisch, vielleicht sind ja noch ein paar Tropfen darin. Allerdings bezweifle ich das, denn ich kenne meine Gäste. Meinen Wein teilen sie bereitwillig bis zum letzten Tropfen, aber meinen Kummer am nächsten Morgen, den will niemand mit mir teilen.«
Ich sagte, aus Verehrung für ihn brächte ich ihm gerne für mein eigenes Geld auch eine große Maß Wein, sofern ihm eine solche Aufdringlichkeit nicht zuwider sei. Sein Antlitz erhellte sich, und noch strahlender wurde es, als er hörte, dass ihn am Abend ein Essen an Kardinal Cesarinis Tafel erwartete.
»Du bist begabt, das sieht man deinen Augen an«, sagte er. »Ich komme nicht umhin, dem großen Kardinal zu gratulieren, dass er einen so klugen Diener in seine Dienste genommen hat. Du begreifst meine Gedanken in Windeseile. Zaudere also nicht, sondern beeile dich lieber, bevor du es dir anders überlegst.«
Ich brachte ihm aus der Schenke einen großen Humpen Wein, und derweil war er aufgestanden, hatte sich die Hose angezogen und sich gekämmt. Nachdem er von dem Wein getrunken hatte, seufzte er und fragte: »Nun, was willst du von mir? Bittere Erfahrungen haben mich gelehrt, dass man in dieser Stadt nichts umsonst erhält. Ein Geschenk muss mit einem Geschenk vergolten werden, und Gunst mit Gunst. Sprich also!«
Demütig sagte ich, ich sähe es als allergrößte Ehre an, wenn er mir eine seiner Dichtungen deklamieren wolle. Er starrte mich ungläubig an und fragte: »Treibst du auch keinen Scherz mit mir? Wenn es Nacht wäre und du wärest betrunken, verstünde ich deinen Wunsch. Aber den Wein hast du ja nicht angerührt. Oder willst du dich bei mir einschmeicheln?«
Diesen Verdacht wies ich eifrig zurück. Da begann er in den Papieren auf seinem Tisch zu blättern, nippte am Wein und las mir einige recht kurze Gedichte vor, wobei er immer wieder auflachte und mich zwischendurch anblickte, so als erheische er Beifall.
»Ich habe da auch eine...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.