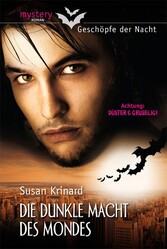Suchen und Finden
1. KAPITEL
26. Oktober 1926, New York City
Das dumpf glucksende schwarze Wasser schlug über ihrem Kopf zusammen. Sie schlug wild um sich, doch ihre Arme und Beine waren so schwer und unbeweglich wie Baumstämme. Hinter ihren Augenlidern zuckte aggressives rotes Licht, sie konnte nicht denken, konnte nichts tun, außer sich auf ihren Instinkt zu verlassen, der sie davon abhielt, den Mund zu öffnen und die widerliche Brühe zu schlucken, die um sie herum waberte.
So also fühlt sich Sterben an?
Der Gedanke kam und ging in einem kurzen lichten Moment, ehe sie ihn begreifen konnte. Sie sank tiefer. Ihre Muskeln gehorchten den schwachen Befehlen ihres Gehirns nicht länger. Ein Fisch driftete neben sie und sah sie erstaunt an. Dann verschwand er in den tintenschwarzen Tiefen. Ihre Lungen begannen zu brennen.
Atme. Atme. Atme …
Ein Strahl aus Luftblasen löste sich von ihren Lippen. Plötzlich kam die Erinnerung zurück. Sie sah hinauf auf den fernen, blassen Schimmer des Mondlichts, das sich auf der Oberfläche des Flusses spiegelte. Es schien Millionen Meilen entfernt zu sein.
Schwimm. Schwimm doch, verdammt.
Aber sie hatte keine Luft mehr. Erlösung schien nicht mehr erreichbar. Sie streckte die Arme aus und klammerte sich an eine Substanz, die ihr durch die Finger glitt. Ein dunkler Vorhang legte sich über ihre Augen. Sie strengte sich ein letztes Mal an und versuchte, ihren schmerzenden Körper ein kleines Stück näher an den Himmel zu schieben.
Etwas griff nach ihrer Hand und packte sie. Ihr Schrei leerte ihre Lungen völlig. Das Letzte, was sie sah, war ein Gesicht … ein Gesicht, das einem Engel gehören mochte … oder dem attraktivsten Teufel, den die Hölle je hervorgebracht hatte.
„Atmen Sie!“
Die Stimme war rau und doch schön, wie eine Musik aus einer anderen Welt. Sie kam von sehr weit weg, einem Ort außerhalb von Raum und Zeit, und doch zog sie sie aus der verführerischen Dunkelheit.
Grobe Hände drehten sie um. Flüssigkeit stieg in ihrem Rachen hoch und ergoss sich aus ihrem Mund. Sie hustete kräftig, und blitzende Funken schwirrten durch ihr Gehirn.
„Atmen!“
Sie keuchte. Gesegneter Sauerstoff strömte in ihre Lunge. Die Hände, die sie geschüttelt und bearbeitet hatten, wurden sanfter und hoben sie gegen eine warme, feste Oberfläche. Sie hörte einen Herzschlag, langsam und gleichmäßig, spürte Muskeln unter einem früher einmal eleganten schwarzen Hemd, roch einen leicht stechenden, aber nicht unangenehmen Duft, als trüge die Person, die sie festhielt, seit Wochen dieselbe Kleidung.
Immer noch benommen und zitternd im kalten Morgenwind, ließ sie sich einfach halten. Es war absurd, sich in den Armen eines vollkommen Fremden so sicher zu fühlen, auch wenn er ihr gerade das Leben gerettet hatte. Verrückt, dass es sich so anfühlte, als könnte sie für immer dort bleiben.
Sie wand sich in den Armen ihres Retters. Er ließ sie los und half ihr, nicht hinzufallen, als sie sich auf dem betagten Holz der Mole hinzusetzen versuchte.
Zum ersten Mal konnte sie sein Gesicht erkennen. Es war der teuflische Engel, den sie im Fluss gesehen hatte. Dort hatte das Brackwasser seine Züge verzerrt. Jetzt, da sie ihn deutlicher erkennen konnte, wusste sie immer noch nicht, ob er nun in den Himmel oder an den anderen Ort gehörte.
Seine Züge waren die eines jungen Mannes. Er war ansehnlich im wahrsten Sinne des Wortes, und das helle Mondlicht betonte noch seine vollkommenen Gesichtszüge. Seine Haut war glatt und frei von Bartstoppeln, auch wenn alles andere an seinem Aussehen darauf schließen ließ, dass er tagelang keinen Rasierer in der Hand gehalten hatte. Seine Wangenknochen waren hoch, das Kinn fest und kantig, sein Haar war dunkel und musste dringend geschnitten werden, die Augenbrauen gerade. Er hatte tief umschattete Augen.
Die Augen waren es, die ihre Aufmerksamkeit am stärksten auf sich zogen. Gwen konnte keine Farbe erkennen, aber das war auch nicht wichtig. Sie gehörten einfach nicht ins Gesicht eines guten Samariters, der wahrscheinlich sein Leben riskiert hatte, um eine ihm vollkommen Fremde zu retten. Sie gehörten nicht zu einem Mann Mitte zwanzig, der noch wenigstens vierzig gute Jahre vor sich hatte. Sie waren so gefährlich wie ein Sturm, kurz bevor er losbricht, grauenvoll. Wenn er je gelächelt hatte, dann lag das sicher so weit zurück, dass sie es sich kaum vorstellen konnte.
Die meisten Frauen – ja, sogar die meisten Männer – hätten sich unter diesem unbarmherzigen Blick gekrümmt. Nicht aber Gwen Murphy. Sie betrachtete ihn weiter, bemerkte die ausgefransten Manschetten seines Hemdes, die Jacke, die schon bessere Tage gesehen hatte, die geflickte Hose und die abgelaufenen Schuhe. Dieser Kerl hatte es nicht leicht im Leben, wahrscheinlich war er arbeitslos. Menschen wie ihn gab es in New York immer noch, auch wenn die Geschäfte blendend liefen und fast jeder am allgemeinen Wohlstand teilzuhaben schien.
Jeder, bis auf einige Unglückliche: Männer, die im Krieg gewesen waren, Witwen, die ihre Kinder ohne Vater aufziehen mussten, Immigranten, die sich noch nicht zurechtgefunden hatten, Alkoholiker, die ihr Geld nicht zusammenhalten konnten.
Ihr Retter sah gesund und unversehrt aus. Er schien nicht betrunken zu sein. Er konnte ein Ausländer sein, der nicht genug Englisch sprach, um einen vernünftigen Job zu bekommen.
Es gab nur einen Weg, das herauszufinden.
„Sie haben mir das Leben gerettet“, sagte sie keuchend, „danke.“
Der Mann bewegte den Kopf und sah ihr immer noch direkt in die Augen.
Sie räusperte sich und zog sich den nassen Handschuh von der zitternden Hand. „Ich bin Gwen Murphy“, sagte sie und streckte ihm die Hand entgegen.
Er sah auf ihre zitternden Finger, als vermutete er, sie habe eine widerliche und ansteckende Krankheit. Gwen wollte die Hand gerade wieder fortziehen, als er sie mit dem gleichen starken Griff packte, mit dem er sie aus ihrem wässrigen Grab gezogen hatte.
„Dorian“, sagte er und erfüllte die Luft wieder mit dieser seltsamen Musik. „Dorian Black.“
Gwen musste fast lachen. Sie merkte, dass unter ihrer erzwungenen Ruhe die Hysterie lauerte, und schluckte das Lachen hinunter. Wenn sie erst einmal damit anfing, würde es ihr vielleicht schwerfallen, wieder aufzuhören. Und Mr. Black sah nicht so aus, als würde er so eine Reaktion gutheißen.
„Mr. Black“, sagte sie und erwiderte seinen Händedruck, so fest sie konnte, „ich weiß nicht, wie Sie es geschafft haben, genau dann aufzutauchen, als ich Sie am dringendsten brauchte, aber ich bin Ihnen sehr dankbar.“
Er ließ ihre Hand los. „Es war mir keine Mühe.“ Er betonte jedes Wort sehr genau, als wäre Englisch eine Fremdsprache. „Benötigen Sie einen Arzt?“
Sie unterdrückte ein Zittern. „Es geht mir gut. Ich bin nur etwas durchgefroren. Und voller Wasser.“
Immer noch erhellte kein Lächeln seine wie gemeißelten Züge, aber er runzelte die Stirn, sodass sein Gesicht fast sorgenvoll aussah. Er zog seine Jacke aus und legte sie Gwen um die Schultern. Sie war nicht ganz sauber, aber Gwen war dankbar für die Wärme und die Geste.
„Danke.“
Er hob eine Schulter und zeigte damit, wie unangenehm ihm diese Situation wirklich war. „Wie konnte das passieren?“
Die Frage überraschte Gwen. Black war so wortkarg. Vielleicht interessierte es ihn auch gar nicht, aber sie musste es ihm anrechnen, dass er es wenigstens versuchte.
„Ich bin Reporterin für den Sentinel“, sagte sie. „Ich war auf den Docks, weil ich einer Sache auf der Spur war. Und dann haben mich auf einmal ein paar Gangster angesprungen.“ Plötzlich war ihr das Ganze sehr peinlich. Sie befühlte die anschwellende Beule an ihrem Hinterkopf. „Aber so leicht habe ich es ihnen nicht gemacht. Als ich mich gewehrt habe, hat mir einer von denen eins übergezogen und mich in den Fluss geworfen.“
Black kniff die Augen zusammen. Er sah den Pier hinauf über die Uferpromenade, als könnte er dort noch die jungen Männer finden, die ihr das angetan hatten. Sogar wenn sie geblieben wären, um sicherzugehen, dass ihr Opfer ertrunken war, würde man sie nicht mehr sehen, die nächste Straßenlaterne war fast hundert Meter entfernt, und es gab eine Menge Verstecke. Die Sonne würde gleich aufgehen, die ersten Matrosen und Hafenarbeiter liefen bereits in den Docks. Wenn nicht gerade diese Mole einigermaßen verlassen gewesen wäre, wären die Gangster mit ihrem Angriff gar nicht erst so weit gekommen.
„Ist es eine Angewohnheit von Ihnen, sich mitten in der Nacht in Hell’s Kitchen aufzuhalten?“, fragte Black, der sich ihr mit einer gewissen Bedrohlichkeit wieder zuwandte.
Gwen setzte sich aufrechter hin. „Gewisse Aktivitäten fallen in der Dunkelheit weniger auf. Ich wollte nicht gesehen werden.“
„Jemand hat Sie gesehen.“
„Aber niemand von denen, die mich nicht sehen sollten.“
„Und wer wäre das genau, Miss Murphy?“
Plötzlich spürte Gwen, dass ihr übel wurde. „Das ist streng vertraulich“, sagte sie. Ihr waren die Knie weich, als...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.