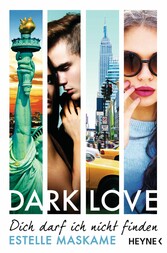Suchen und Finden
Kapitel 1
Dreihundertneunundfünfzig Tage.
So lange warte ich nun schon.
Ich habe jeden einzelnen Tag gezählt.
Es ist dreihundertneunundfünfzig Tage her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
Gucci hebt die Pfote an mein Bein und begrüßt mich schwanzwedelnd. Ich lehne mich gegen meinen Koffer, und während ich zum Wohnzimmerfenster hinausstarre, prickelt eine nervöse Unruhe in mir. Es ist kurz vor sechs Uhr morgens, gerade eben ist die Sonne aufgegangen. Vor etwa zwanzig Minuten fing sie an, die Dunkelheit zu durchbrechen, und ich war gefesselt vom Anblick der Straße, wie wunderschön sie aussah, wie das Sonnenlicht von den Fahrzeugen am Straßenrand reflektiert wurde. Dean sollte jeden Moment eintreffen.
Ich betrachte den riesigen Deutschen Schäferhund zu meinen Füßen und kraule ihn hinter den Ohren. Bis Gucci sich umdreht und in die Küche davontapst. Also starre ich wieder aus dem Fenster und gehe im Geiste durch, ob ich alles eingepackt habe. Was mich nur noch nervöser macht, daher rutsche ich runter von meinem Koffer und klappe ihn noch einmal auf. Ich wühle in dem Stapel kurzer Hosen, in den Chucks, von denen ich gleich mehrere Paare mitgenommen habe, und in der Sammlung an Armbändern.
»Eden, glaub mir, du hast alles, was du brauchst.«
Ich höre auf, in meinen Sachen zu kramen, und blicke auf. Mom steht im Morgenmantel in der Küche und mustert mich über den Tresen hinweg, die Arme vor der Brust verschränkt. Wie schon die gesamte letzte Woche hat sie diesen Ausdruck im Gesicht. Halb besorgt, halb genervt.
Seufzend stopfe ich alles zurück in den Koffer. Dann schließe ich ihn, stelle das Ding auf die Räder und stehe auf. »Ich bin nur so nervös.«
Keine Ahnung, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Ich bin nervös, ja, weil ich keinen Schimmer habe, was mich erwartet. Dreihundertneunundfünfzig Tage sind eine lange Zeit, da kann sich so einiges tun. Alles könnte plötzlich anders sein. Deshalb habe ich wohl Angst. Ich habe aber genauso Angst, dass sich nichts verändert hat. Ich habe Angst, dass alles wieder auf mich einstürmt, sobald ich ihn sehe. Das ist das Problem an Entfernungen: Entweder helfen sie einem, einen bestimmten Menschen zu vergessen, oder es wird einem erst bewusst, wie sehr einem dieser Mensch fehlt.
Und im Moment könnte ich nicht sagen, ob ich einfach nur meinen Stiefbruder vermisse oder den Menschen, in den ich verliebt war. Schwer zu sagen, was es ist. Weil es in beiden Fällen um ein und dieselbe Person geht.
»Aber nicht doch«, sagt meine Mom. »Es gibt keinen Grund, nervös zu sein.« Sie kommt zu mir ins Wohnzimmer, und Gucci springt hinter ihr her. Kurz blinzelt sie zum Fenster hinaus, ehe sie sich auf der Armlehne des Sofas niederlässt. »Wann wollte Dean denn kommen?«
»Müsste gleich da sein«, sage ich ganz ruhig.
»Tja, ich hoffe ja, du bleibst im Stau stecken und verpasst deinen Flieger.«
Zähneknirschend wende ich mich ab. Mom war vom ersten Moment an dagegen. Sie will keinen einzigen Tag vergeuden, und sechs Wochen wegzufahren ist für sie nichts anderes als reine Zeitverschwendung. Denn uns bleiben nur noch wenige Monate, bevor ich im Herbst nach Chicago ziehe. Für sie ist das ungefähr so, als würde sie mich dann nicht wiedersehen. Nie wieder. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Wenn ich die Abschlussprüfungen erst einmal hinter mir habe, bin ich nächsten Sommer wieder daheim.
»Musst du so pessimistisch sein?«
Endlich breitet sich doch ein Lächeln auf Moms Gesicht aus. »Ich bin nicht pessimistisch, ich bin nur eifersüchtig und ein kleines bisschen egoistisch.«
In dem Moment hört man ein Fahrzeug herannahen. Ich weiß, dass es Dean ist, noch bevor ich ihn sehe, und als das Auto in die Einfahrt biegt, verstummt das leise Schnurren des Motors. Jack, der Freund meiner Mom, hat seinen Wagen etwas weiter oben geparkt, daher muss ich den Hals recken, um ihn zu sehen.
Gerade öffnet Dean die Fahrertür und steigt aus. Seine Bewegungen sind behäbig, und sein Gesicht zeigt keinerlei Regung, fast so, als wäre er am liebsten gar nicht hier. Das überrascht mich nicht im Geringsten. Gestern Abend war er recht einsilbig mir gegenüber und hat die meiste Zeit nur auf sein Handy gestarrt. Als ich dann ging, begleitete er mich noch nicht mal zu meinem Wagen wie sonst immer. Er ist ein kleines bisschen sauer auf mich, genau wie Mom.
Ein Kloß formt sich in meiner Kehle, und ich versuche, ihn zu schlucken, während ich den Griff an meinem Koffer ausziehe. Dann rolle ich mein Gepäck zur Haustür, halte aber inne, um Mom mit gerunzelter Stirn einen letzten bangen Blick zuzuwerfen. Jetzt ist es also so weit. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen.
Dean klopft gar nicht erst an, bevor er das Haus betritt. Das tut er nie; muss er auch nicht. Aber die Tür schwingt langsamer auf als sonst, ehe er reinkommt. Er sieht müde aus. »Morgen.«
»Guten Morgen, Dean«, sagt Mom. Ihr Lächeln wird breiter, und sie streckt die Hand aus und drückt sanft seinen Arm. »Sie wartet schon.«
Deans dunkle Augen zucken zu mir, und er begegnet meinem Blick. Normalerweise lächelt er, wenn er mich sieht, doch heute bleibt sein Ausdruck leer. Allerdings zieht er kaum merklich die Augenbrauen hoch, als wollte er fragen: »Tja, du willst also wirklich fahren?«
»Hey«, begrüße ich ihn, doch ich bin so nervös, dass es ganz schlapp und jämmerlich schwach klingt. Ich schaue runter auf meinen Koffer und dann wieder hoch zu Dean. »Danke, dass du dir an deinem freien Tag die Zeit nimmst.«
»Erinnere mich bloß nicht daran«, sagt er, lächelt nun aber doch, weshalb ich mich gleich besser fühle. Er tritt einen Schritt vor und nimmt mir das Gepäck ab. »Ich könnte jetzt im Bett liegen und bis Mittag pennen.«
»Du bist einfach so gut zu mir.« Ich trete näher und schlinge die Arme um ihn. Und dann vergrabe ich mein Gesicht an seinem Hemd, und er lacht und drückt mich ganz fest. Ich lege den Kopf in den Nacken und sehe ihn unter den Wimpern von unten her an. »Nein, mal im Ernst.«
»Oooch«, gurrt meine Mom, und erst da wird mir bewusst, dass sie ja auch noch anwesend ist. »Ihr beide seid ja so was von süß.«
Ich werfe ihr einen warnenden Blick zu, ehe ich wieder Dean anschaue. »Wir sollten aufbrechen.«
»Nein, warte, hör mir erst noch zu.« Mom steht auf, und das knappe Lächeln wird verdrängt von einem missmutigen Stirnrunzeln. Ich habe die Befürchtung, das könnte zu einem Dauerzustand geworden sein, bis ich wieder zurückkomme. »Fahr nicht mit der U-Bahn. Rede nicht mit Fremden. Und setz bloß keinen Fuß in die Bronx. Ach ja, und komm bitte lebend wieder heim.«
Ich verdrehe die Augen so weit ich kann. Einen ganz ähnlichen Vortrag musste ich mir nämlich vor ziemlich genau zwei Jahren anhören, als ich nach Kalifornien ging, um wieder Kontakt zu Dad zu knüpfen. Nur dass die Warnungen damals in erster Linie ihn betrafen. »Schon klar«, entgegne ich. »Sag doch einfach, ich soll keine Dummheiten machen.«
Sie sieht mich fest an. »Ganz genau.«
Ich mache mich von Dean los, gehe zu ihr und lege die Arme um sie. Wenn ich sie umarme, hält sie wenigstens die Klappe. Das funktioniert immer. Sie drückt mich ganz fest und seufzt. »Ich werde dich vermissen«, murmle ich gedämpft.
»Und du weißt ganz genau, dass du mir auch fehlen wirst«, sagt sie und löst sich aus der Umklammerung, die Hände immer noch auf meinen Schultern. Dann wirft sie einen Blick auf die Uhr in der Küche und schiebt mich sanft in Richtung Dean. »Ihr macht euch besser auf den Weg. Sonst verpasst du doch noch deinen Flieger.«
»Genau, wir fahren besser«, meint Dean. Er reißt die Haustür auf und zieht meinen Koffer über die Schwelle. Dann hält er inne. Vielleicht wartet er ab, ob meine Mom noch ein paar überflüssige Ratschläge auf Lager hat, ehe ich verschwinde. Zum Glück aber ist dem nicht so.
Ich schnappe mir meinen Rucksack vom Sofa und folge Dean ins Freie, aber nicht, ohne mich noch einmal umzudrehen und Mom ein letztes Mal zuzuwinken. »Wir sehen uns dann in sechs Wochen.«
»Erinnere mich bloß nicht daran«, sagt sie, und damit wirft sie die Haustür zu. Ich verdrehe wieder die Augen und marschiere in Richtung Einfahrt. Sie fängt sich schon wieder. Irgendwann.
»Tja«, ruft Dean mir über die Schulter zu, während ich ihm zu seinem Wagen folge, »wenigstens bin ich nicht der Einzige, den du hier allein sitzenlässt.«
Ich kneife die Augen ganz fest zu und raufe mir das Haar, während ich neben der Beifahrertür stehe und warte, dass Dean meine Sachen im Kofferraum verstaut. »Bitte, Dean, fang nicht wieder an.«
»Aber es ist nicht fair«, brummt er. Wir steigen im gleichen Moment ein, und kaum hat er die Tür hinter sich zugezogen, seufzt er theatralisch. »Warum musst du denn unbedingt gehen?«
»Jetzt mach doch bitte kein Drama draus«, sage ich, weil ich wirklich nicht verstehe, wo das Problem liegt. Er und Mom waren von Anfang an gegen die Idee mit New York. Fast so, als hätten sie Angst, ich könnte nie mehr wiederkommen. »Ist doch bloß ein Kurztrip.«
»Ein Kurztrip?«, schnaubt Dean verächtlich. Trotz seiner miesen Laune gelingt es ihm, den Motor zu starten und endlich loszufahren. Er stößt rückwärts raus auf die Straße und steuert Richtung Süden. »Du bist ganze sechs Wochen weg. Und danach ziehst du nach Chicago. Mir bleiben also nur noch fünf Wochen mit dir. Das ist nicht viel.«
»Ja, schon, aber wir machen einfach das Beste aus diesen fünf Wochen.« Mir ist bewusst, dass nichts, was ich...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.