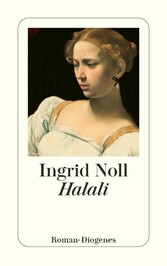Suchen und Finden
{7}1 Schnee von gestern
Beim letzten Arztbesuch fiel mir wieder auf, wie viel sich doch im Vergleich zu früher geändert hat. Noch vor einigen Jahren lasen die meisten Patienten im Wartezimmer die mehr oder weniger zerfransten Lesemappen oder starrten mit düsteren Gedanken taten- und wortlos vor sich hin. Würde man heute von oben auf sie herniedersehen, könnte man denken, sie würden silberne Löffel putzen, stricken oder häkeln, so versonnen neigen sie sich über einen kleinen Gegenstand, den sie mit flinken Fingern bearbeiten. Dieses Ding nannte ich bisher Handy, doch mittlerweile gibt es offenbar noch Smartphones, Tablets und Gott weiß was sonst. Was die Patienten wohl mit ihren Geräten so treiben, während sie warten? Die letzten Details zu ihren Wehwehchen in Erfahrung bringen oder doch lieber spielen? Ich selbst habe mich früher im Wartezimmer immer gern mit von anderen Leuten begonnenen Kreuzworträtseln abgelenkt. Die Lesemappen gibt es zwar heute noch, doch sie werden {8}nur von uns Alten durchgeblättert, und an die Rätsel hat sich meistens keiner herangewagt. Mir fehlt dann das Vergnügen, es besser als meine Vorgänger zu können.
Genau wie ich lebt auch meine Enkelin Laura allein und zu meinem Glück sogar im selben Hochhaus. Für eine zweiundachtzigjährige Witwe wie mich ist diese kleine Wohnung ideal, für Laura als Single wahrscheinlich ebenso. Wenn sie von der Arbeit heimkommt, schaut sie oft noch bei mir herein. Gelegentlich habe ich uns etwas Bodenständiges gekocht, manchmal bringt sie etwas zum Essen mit. Es ist schön, dass sie mir aufmerksam zuhört, wenn ich von meiner Jugendzeit erzähle, denn uns verbindet so mancherlei. So hat meine Enkelin nicht zuletzt ein ähnliches Arbeitsfeld gewählt wie ich.
Meinen ehemaligen Beruf als Sekretärin gibt es zwar immer noch, aber die Vorzimmerdamen heißen jetzt Assistentin des Geschäftsführers, Office Managerin oder so ähnlich. Als ich nach der Handelsschule mit der Arbeit begann, war ich unverheiratet, also ein Fräulein. Meine Enkelin duzt sich mit ihrem Chef, beherrscht weder Steno noch das Zehnfingersystem, hat stattdessen an einer Fachhochschule studiert und nennt sich Betriebswirtin für Controlling. {9}Während ich früher im Innenministerium vor einer schweren Adler-Schreibmaschine saß, hockt sie vor einem Computer. Auch zu Hause hat sie immer ihr Smartphone neben sich liegen, während ich oft ein Buch zuschlage, sowie sie über die Schwelle kommt. Doch ich denke, Laura muss – genauso wie wir im vergangenen Jahrhundert – dem Abteilungsleiter gehorchen und diplomatisch mit seinen Launen umgehen. Und sicherlich macht sie mit ihren Kolleginnen auch ebenso viel Blödsinn wie ich in meinen jungen Jahren. Kichern, tratschen, ein wenig intrigieren, sich auf eine hastig gerauchte Zigarette verabreden, mit attraktiven Kollegen anbändeln, so etwas stirbt nie aus. Ich hoffe bloß, dass Laura sich nicht auf finstere Machenschaften einlässt, wie ich es einmal tat.
Neulich fuhren wir gemeinsam zum Supermarkt. Um ein wenig anzugeben, notierte ich die Einkaufsliste in Steno. Laura staunte nicht schlecht, doch als ich die Kurzschrift am Ende selbst nicht mehr lesen konnte, lachte sie schallend. Um nicht als humorlose alte Schachtel dazustehen, tippte ich an meinen weißhaarigen Kopf und sagte: »De-be-de-de-ha-ka-pe!« Laura starrte mich verständnislos an, und ich musste erklären, dass dies in meiner Jugend die Kurzformel war für: Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Laura grinste bloß. In ihrer Gesellschaft {10}fühle ich mich manchmal wieder jung und übermütig.
»Weißt du eigentlich, was ein MOF ist?«, fragte Laura mich kürzlich. »Das ist ein Mensch ohne Freunde!« Eine Weile überlegten wir gemeinsam, wie viele wir von dieser Sorte kannten, bei ihr waren es vor allem zwei ehemalige Lehrer und ein neuer Mitarbeiter. Doch auch mir kam bei diesem neudeutschen Ausdruck jemand in den Sinn: ein Regierungsrat im Innenministerium, dem wir den Spitznamen der Jäger aus Kurpfalz gegeben hatten.
Natürlich war er kein Jäger, sondern hatte bloß diesen Allersweltsnamen und stammte aus der Pfalz, womöglich war er gemeinsam mit Helmut Kohl zur Schule gegangen. Das uralte Volkslied musste man damals noch in der Grundschule singen, wobei – wie Laura dank Wikipedia ermittelte – die frivolen Strophen in den Schulbüchern weggelassen wurden. Ein Schürzenjäger war dieser Burkhard Jäger aus meiner Abteilung schon gar nicht, unscheinbar und linkisch, wie er war. Aber gerade weil er so langweilig und brav, so grau und spießig wirkte, machten wir Frauen uns ständig Gedanken über sein Privatleben. Falls es auch für Männer die Bezeichnung graue Maus gibt, dann traf es auf ihn zu. Anfangs setzten wir uns abwechselnd in der Kantine neben {11}ihn und versuchten ihn auszuhorchen. Doch nie kam etwas dabei heraus, er blieb stocksteif und hielt sich bedeckt. Meine Kollegin Karin Bolwer, die nicht nur das Büro, sondern auch den Chef mit mir teilte, hat sogar einmal versucht, ein wenig mit ihm zu flirten, bloß um seine Reaktion zu testen. Doch Herr Jäger war entweder naiv oder schwul oder immun gegen weibliche Reize, wir wurden aus ihm nicht schlau.
Bevor ein Mädchen heiratete, wohnte es in den fünfziger Jahren oft noch bei den Eltern, vor allem aus finanziellen, ein wenig aber auch aus moralischen Gründen. Studentinnen hatten natürlich größere Freiheiten, aber sie waren zahlenmäßig in der Minderheit. In meinem Fall mussten meine Eltern einsehen, dass ich keinen geeigneten Job in unserem Eifelkaff finden würde, und ließen mich daher 1955 schweren Herzens mit zwanzig nach Bonn ziehen, das seit sechs Jahren die neue Hauptstadt war. Vielleicht hegten sie insgeheim auch die Hoffnung auf einen soliden Schwiegersohn mit Beamtenstatus. Die ehemalige Kleinstadt am Rhein boomte, wie man heute sagen würde, Konrad Adenauer verkörperte als der erste Bundeskanzler einen Neuanfang, Botschaften ließen sich in alten Godesberger Villen nieder, Ministerien wurden gebaut oder provisorisch in ehemaligen Kasernen untergebracht. Gleich {12}nach meiner ersten Bewerbung landete ich als Stenotypistin in einem dieser grauen Betonkästen in der Graurheindorfer Straße, zog vom Land in die Stadt und wohnte in einem möblierten Zimmer bei einer Kriegerwitwe. Herrenbesuch war nicht gestattet, denn es galt ja noch der Paragraph 180, der Kuppelparagraph. Eine Vermieterin konnte sogar mit Gefängnis bestraft werden, wenn sie der »Unzucht« Vorschub leistete. Ein Gesetz durchaus im Sinne der Eltern, denn es gab noch keine Antibabypille. Auch tolerante und aufgeschlossene Mütter litten unter der Horrorvorstellung, ihre Tochter könnte viel zu früh und vom falschen Kerl geschwängert werden. »Kleine Sünden bestraft Gott sofort, große in neun Monaten«, pflegte man zu sagen.
Das Haus meiner Wirtin lag in Bad Godesberg, das mittlerweile zu Bonn gehört. Zwar musste ich fast eine Stunde mit der Straßenbahn bis zum Ministerium fahren, aber das war es mir wert. Von meinem Zimmer aus war ich in fünf Minuten am Rhein, konnte spazieren gehen und von meiner Lieblingsbank aus den Raddampfern zusehen. Den Geruch nach rostigem Eisen und Flusswasser werde ich nie vergessen. Mein Zimmer war klein und nach heutigen Maßstäben dürftig eingerichtet. Zum Schlafen diente eine durchgelegene Couch, die tagsüber mit einer karierten Wolldecke zum Sofa umgerüstet {13}wurde. Das Badezimmer durfte ich zwar mitbenutzen, aber warmes Wasser gab es nur am Samstag, und ein Wannenbad musste extra bezahlt werden.
Bei meinem schmalen Gehalt waren vier Mark im Monat keine Kleinigkeit. Deswegen nahm ich anfangs eine andere Gelegenheit wahr, die sich durch den Beruf ergab. Wie ich schon sagte, war das Innenministerium in einer ehemaligen Kaserne untergebracht. Im Keller befanden sich Duschen, nicht etwa in einzelnen Kabinen, sondern in Reih und Glied – wie es für Soldaten üblich war. Da längst nicht alle Angestellten zu Hause ein eigenes Bad besaßen, durften sie aus hygienischen und sozialen Gründen einmal in der Woche brausen, dienstags die Männer, freitags die Frauen. An diesen Tagen sah man die Belegschaft mit Handtüchern, Duschhauben, Shampoo, Föhn und Seifen in den Keller eilen. Ältere Frauen, auf rheinisch Möhnen genannt, waren nicht gerade begeistert, sich in jener prüden Zeit vor ihren Kolleginnen auszuziehen, und mieden die Massenreinigung. Aber wir jungen Mädchen fanden es toll, alle Wasserhähne aufzudrehen und ausgelassen von einer Brause zur nächsten zu wechseln. Bis etwas geschah, das mich eine Abneigung gegen Duschen entwickeln ließ, noch lange bevor ich Hitchcocks Psycho sah.
{14}Eines Tages machte nämlich das Gerücht die Runde, wir Frauen würden beim Duschen beobachtet. Nein, versteckte Kameras gab es damals noch nicht. Doch über dem Keller lag ein wenig benutzter Lagerraum, wo uralte Akten verstaubten und Büromaterial aufbewahrt wurde. Einer der Registratoren hatte gelegentlich hier zu tun und hatte dort auch seine Schnapsflaschen untergebracht. Eines schönen Tages war er so betrunken, dass er torkelte und stürzte. Bei dem Versuch, sich wieder aufzurappeln, bemerkte der Mann eine Unebenheit im Boden, weil jemand einen Schlitz im Untergrund dilettantisch mit Wellpappe zugestopft hatte. Als er das Guckloch freilegte, sah er direkt hinunter in den Duschraum. Wenn er ein kluger Ermittler gewesen wäre, hätte er sich auf die Lauer gelegt, um den Spanner beim nächsten Frauentag zu ertappen. Doch er konnte...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.