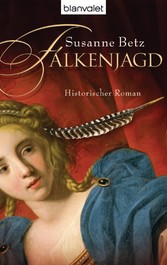Suchen und Finden
1
In den meisten Schüsseln schwammen wieder bleich gekochte Rüben. In anderen sackte fahler Kohl in sich zusammen. Friederike hatte es geahnt. Nur auf einer Platte dampfte ein Wildschweinbraten, garniert mit säuerlich in die Nase stechenden Kaldaunen. Wie jeden Mittag genügte Friederike ein Blick, um die Tafel abzuschätzen. Sofort wusste sie, wie viel jedes der Kinder erwarten konnte. An diesem Julimorgen des Jahres 1728 hatte ihr allerdings ein Lakai etwas krümeliges Brot aus der Hofbäckerei zugesteckt, so dass ihr Magen nicht so leer war wie sonst. Ihr dicker, sechsjähriger Bruder August Wilhelm, der immer neben dem Vater sitzen durfte, sagte unverdrossen fröhlich wie einen Abzählreim das Tischgebet herunter. Der König küsste sein Lieblingskind auf die breite Stirn und legte ihm eigenhändig ein Stück Fleisch auf den Teller. Beide begannen zu schmatzen.
Friederike spürte einen Rempler an ihrer linken Seite, und schon schob Lottine ihr die heiße Bratenportion der ältesten Schwester Wilhelmine in die Hand, die wie üblich unter dem Tisch an den Bruder Friedrich weitergegeben werden sollte. Wenn der Vater nur nichts merkte.
Aber heute verzog sich sein massiges Gesicht nicht wie sonst so oft gleich zu Beginn des Essens zu einer finsteren Grimasse. Wohlwollend schaute der König auf seine Kinderschar, die wie bei einer Bürgersfamilie mit ihm und der erneut schwangeren Königin ohne großes Zeremoniell an einem nur mit Zinntellern gedeckten Tisch speiste. Friederike wusste, dass ganz Europa über diesen Brandenburger Emporkömmling und seinen kümmerlichen Hof spottete. Ihre Mutter, die Tochter Georgs I. von England, sagte es ihr oft genug. Nicht nur, dass er selbst den wöchentlichen Speiseplan für Schloss Wusterhausen zusammenstellte und nur deftige Hausmannskost – noch dazu viel zu wenig – auftragen ließ, er feilschte auch um jeden Kreuzer, damit er noch mehr Monturen für noch mehr Soldaten kaufen konnte. Am Dresdner Hof dagegen wurden Schwalbennester aus China zu Suppen verkocht, um für die Sensation eines einzigen rauschenden Fests zu sorgen. Man trug dort Schwindel erregend hohe Türme aus Zuckermasse und Marzipan auf, über die man neuerdings auch in Versailles redete. Friederike hatte im Gegensatz zu den kleineren Geschwistern immerhin schon Konfekt gegessen, aber erst nachdem sie dreizehn geworden war und zu den Empfängen ihrer Mutter zugelassen wurde. Vor deren Boudoir und Spieltischen musste nämlich auch der Geiz des Vaters strammstehen.
»Ickerle, hör jetzt gut zu«, sagte der König und rülpste nach einem großen Schluck Bier.
»Mein liebes Ickerle, du machst deinen Vater nach seinem vielen Kummer mit der englischen Kanaille heut zu einem frohen Menschen, der sich endlich wieder an Gottes hellem Tag freuen kann.«
Die Lakaien blieben, die Vorlegegabeln noch in der Luft, reglos stehen. Die Königin riss die Augen auf und presste die rechte Hand auf ihren gewölbten Leib. Wilhelmine, der das Schimpfwort gegolten hatte, suchte panisch den Blick des Kronprinzen, an dessen Hals in Sekundenschnelle rote Flecken zu leuchten begannen.
Friederike legte langsam Messer und Gabel zur Seite und schaute den Vater über den Tisch hinweg stumm an. Sie fror vor Angst, aber man sah es ihr nicht an.
Der König bekam, noch bevor er weitersprach, feuchte Augen. Der Mann, der seine Töchter und Söhne mit Stuhlbeinen schlug, war gern und oft gerührt.
»Ich bin mir heut Morgen mit Hofmeister Herrn von Bremer, der die Verhandlungen für die verehrte Ansbacher Markgräfin führt, über alle Modalitäten und auch das Geld einig geworden.«
Der schwere Mann im schlichten dunkelblauen Uniformrock eines Obersten schnaufte noch einmal schwer ein und aus und fuhr dann fort. »Der Ehekontrakt kann nun also als ein schönes Stück Einigkeit unter uns Brandenburgern fixiert werden. Unser Haus muss wieder zusammenwachsen und Preußen im Süden des Reiches Ansehen gewinnen. Und du, Ickerle, sollst mir den ersten Enkel schenken …«
Der König verstummte, weil ihm jetzt die Tränen so heftig aus den Augen quollen, dass er sich in seine Serviette schnäuzen musste.
Ein pfeilspitzer Blick der Mutter durchbohrte Friederikes Gefasstheit. Mit Mühe hielt sie auf ihrem Stuhl die Balance. Ihre Hände klammerten sich an die Tischplatte. Ansbach also. Markgräfin von Ansbach. Friederike sagte nichts. Im Mund lag ihr ein Stück ledriger Kohl, und sie hatte bislang noch kein Fleisch bekommen.
»Ein guter Bursch soll er sein, der Ansbacher Vetter. Keiner von den Tagedieben mit seidenen Ärschen und äffischen, gottlosen Manieren, darum will ich ihn auch, wenn er herkommt, in mein Tabakskollegium einladen. Freilich hat der Ansbacher leere Taschen. Aber die werde ich ihm meinetwegen und deinetwegen stopfen.«
Der König lachte rau und trank wieder gierig aus seinem Krug, wobei er Friederike mit seinen winzig kleinen Augen fest im Blick behielt.
»Lutherisch musst du halt werden, weil sich die Vettern unten im Süden nie mit der viel gottgefälligeren Lehre Calvins, die uns und den guten Holländern so viel Nutzen bringt, anfreunden konnten. Vielleicht hat Gott den Armen aber auch die Erleuchtung verwehrt und bewusst nur wenigen …«
Wieder überkam den Mann, der vor fünfzehn Jahren von seinem Vater ein durch Schwelgereien, Mätressen und Faulheit zerlumptes, bettelarmes Land übernommen hatte, ein so übermächtiges Gefühl, dass seine Worte in Schluchzen untergingen. Fünfzehn Jahre hatte er, Friedrich Wilhelm, jeden Knopf, der für seine Soldaten gebraucht wurde, extra registrieren lassen. Systematisch merzte er die geldverschleudernde Wollust der Spitzen, Seidenstrümpfe, italienischen Opern, philosophischen Traktate und sonstigen Hurereien des Geistes und des Fleisches aus, die nur den ausländischen Händlern Reichtum brachte, das Land dagegen in Armut stürzte. Der König trug schwer an seiner Bürde. Er war kein glücklicher Mensch. Tief im Herzen wünschte er sich nichts mehr, als ein Bürger Hollands zu sein. Inmitten einer Gemeinschaft anderer herzhafter und hart arbeitender Herren, auf deren Rechtschaffenheit Gottes Wohlgefallen ruhte. Aber er war nun mal in dieses Joch gespannt und musste als Amtmann Gottes den störrischen Preußen Sparsamkeit und Pflichterfüllung beibringen. Die ihn dafür allerdings so wenig liebten wie seine eigenen Kinder.
Bei diesem Gedanken angekommen hätte Friedrich Wilhelm am liebsten mit beiden Händen den Tisch umgestoßen, an dem seine Frau saß, die er nie betrog und der er brav Jahr für Jahr ein Kind machte, was ihm von ihrer Seite nichts als Verachtung einbrachte. Und erst sein läppischer erster Sohn, der heimlich französische Bücher kaufte und schiefe Blicke mit Wilhelmine, der Kanaille von Tochter austauschte, die gegen ihn intrigierte, bloß um nach England zu heiraten. Das Blut wallte in ihm auf, denn das Bier hatte ihn heute noch nicht genügend ermüdet.
»Wenn mein Vater es wünscht, dann heirate ich den Markgrafen von Ansbach.«
Friederike, die keiner weiter beachtet hatte, weil alle die Sekunden bis zum Ausbruch des Königs zählten, sagte diesen Satz laut und deutlich.
Der König reagierte nicht gleich, denn schon gärte wieder Misstrauen in ihm. Hatte aus der Stimme seiner Tochter vielleicht mehr Entschlossenheit als Gehorsam geklungen? Ihr hatte er bislang immer getraut. Friederike gehörte nicht zu den Speichelleckern und aalglatten Lügnern, die an seinem Hof gegen ihn arbeiteten. Gottlob durchschaute er sie alle. Seine zweitälteste Tochter war so wie er, geradeheraus, sparsam und mit einem erstaunlich guten Sinn für die Realität. Trotzdem musste er immer auf der Hut sein. Während er sich dafür entschied, ihr wortreich und herzlich zu ihrer guten Wahl zu gratulieren, studierte er gleichsam zum Abschied ihre äußere Erscheinung noch einmal genau.
Eine Schönheit war sie durchaus, obgleich keine strahlende. Nase, Kinn, Wangenknochen ergaben ein hübsches, noch rundes Kindergesicht. Ihren Teint hatten gottlob bislang keine Pockennarben verdorben. Die Augen, die musste man wirklich extra loben, so schimmernd blau und groß waren sie. Das mit dem Bein, das jetzt ein wenig lahmte, tat ihm leid. Ein Mädchen von vierzehn Jahren, mit noch etwas eckigen Schultern und zarter Brust. Gott gebe, dass sie so schnell und leicht Kinder empfangen und gebären würde wie ihre Mutter, der sie mehr als die anderen Töchter ähnelte. Obwohl sie natürlich nie die Blicke auf sich ziehen würde wie seine Dorothea Sophie, von der man, als sie jung war, in ganz Europa als der Prinzessin mit der schmalsten Taille und dem vollsten Busen geschwärmt hatte. Darauf war sie immer noch stolz und vor allem darauf, eine Welfin zu sein. Auch das war eine Bürde, die Gott ihm auferlegt hatte. Der König schnaufte wieder sorgenvoll und hob die Tafel wie immer um Punkt ein Uhr auf.
Der kleine, schwergewichtige Mann schlurfte mit den Grimassen Wilhelmines und der herausgestreckten Zunge Friedrichs im Rücken davon. Allein ging er in den Hof und die Stufen hinauf zum Küchenbrunnen. Hier, umgeben von...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.